

Ottomar Enking ▣ Anna Croissant-Rust
Rudolf Greinz ▣ Wilhelm Schussen
Ludwig Thoma ▣ Sophus Bonde
Wilhelm Fischer-Graz
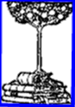
Hamburg-Großborstel
Verlag der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung
1913
1.–10. Tausend

▣ zum 7. Bande der ▣
»Deutschen Humoristen«
| Enking, Ottomar: Das Kriegerfest in Wettorp | 7–32 |
| Croissant-Rust, Anna: Der Herr Buchhalter | 33–48 |
| Schussen, Wilhelm: Pilgrime | 49–71 |
| Greinz, Rudolf: Das Hennendiandl | 73–85 |
| Bonde, Sophus: Jochen Appelbaums Galion | 87–102 |
| Thoma, Ludwig: Unser guater, alter Herzog Karl is a Rindviech | 103–111 |
| Fischer-Graz, Wilhelm: Die Rebenbäckerin | 113–159 |

Die Erzählung »Das Kriegerfest in Wettorp« von Ottomar Enking ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Verlegers abgedruckt aus dem Roman »Ikariden« (Dresden: Verlag von Carl Reißner).
»Der Herr Buchhalter« von Anna Croissant-Rust ist mit gütiger Erlaubnis der Verfasserin und des Verlegers abgedruckt aus Anna Croissant-Rusts Buch »Aus unseres Herrgotts Tiergarten« (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt).
Für den Abdruck der »Pilgrime« schulden wir Herrn Wilhelm Schussen Dank.
»Das Hennendiandl« von Rudolf Greinz ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Verlegers abgedruckt aus Rudolf Greinz' Buch »Bergbauern« (Leipzig: Verlag von L. Staackmann).
Für die Abdruckserlaubnis von »Unser guater, alter Herzog Karl is a Rindviech« von Ludwig Thoma schulden wir dem Verfasser und dem Verlage Albert Langen in München Dank.
»Jochen Appelbaums Galion« von Sophus Bonde ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Verlegers abgedruckt aus Sophus Bondes Buch »Schimannsgarn« (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt).
»Die Rebenbäckerin« von Wilhelm Fischer-Graz ist mit gütiger Erlaubnis des Verfassers und des Verlegers abgedruckt aus Wilhelm Fischers Buch »Unter altem Himmel« (München: Verlag von Georg Müller).

Wenn Thomas Mann der Dichter des niederdeutschen Patriziertums ist, so ist Ottomar Enking der berufene Schilderer des niederdeutschen Kleinbürgertumes. Beide Gesellschaftsschichten umspinnt die leise Tragik: stehen geblieben zu sein, überholt zu sein von einer Zeit der lärmenden Maschinen, der konzentrierten Kräfte und des gesteigerten und gehetzten Lebenstempos. Herrisch verfolgt diese Zeit ihr Ziel und schreitet unerbittlich über die kleinen gedrückten oder verzweifelt aufbegehrenden Existenzen hinweg: über verstörte Patriarchen, die »die Welt nicht mehr verstehen«, und über sehnsüchtige Mädchenseelen, die am Zwiespalt zwischen der beengenden Überlieferung und der lockenden Freiheit zerbrechen. In die behagliche Selbstgenügsamkeit und behäbige Selbstzufriedenheit, mit der sich die Gestalten der Reuterzeit bewegten, kommt nun ein weher Ton wie von einer Glocke, die zersprang. Denn das Gefühl des Überholtseins gibt Bitterkeit oder, vom Betrachter aus, Ironie. Das Genrebild geht durch die Schule der naturalistischen Impression, die Beobachtung wird exakter, schärfer, unbeirrter, erreicht eine verblüffende Fertigkeit, Dinge, Geräusche und Bewegungen sinnfällig zu machen, und[9] stellt die Alltagstypen der deutschen Kleinstadt greifbar nahe und unauslöschlich vor uns hin: mit einem wehmütigen Humor, der zugleich mitfühlende Liebe und ironische Überlegenheit ist und der ihren Untergang ohne jede Sentimentalität verklärt. Enking, der früher Schauspieler, dann Redakteur war und jetzt als freier Schriftsteller in Dresden lebt, ist seiner Geburtsstadt nach Kieler (er wurde dort am 28. September 1867 geboren). Einzelne seiner Werke, so der Roman »Johann Rolfs«, spielen sich auch auf Kieler Boden ab; für seine Hauptwerke ist jedoch Wismar das, was Lübeck für Manns »Buddenbrooks« ist: es ist das »Koggenstedt« jener Romanfolge, als deren Meisterstück mit Fug und Recht die »Familie P. C. Behm« gilt.
L. Adelt.
Gauting,
im September 1913.

Das Kriegerfest in Wettorp.
Viele, viele Nachtsitzungen hatte das »Geschäftsführende und Hauptkomitee für das zwanzigjährige Stiftungsfest des Kriegervereins von Wettorp und Umgegend sowie die Enthüllung des Denkmals für Kaiser Wilhelm den Großen« im Landhause abgehalten, viele Vornotizen und Hinweise hatten in den »Wettorper Nachrichten« gestanden, und viele eifrige Straßenunterhaltungen über das Fest und das Denkmal waren von den patriotischen Bürgern Wettorps gepflogen worden. Ja, viel, viel war geschehen, bis endlich der ersehnte Augusttag erschien, der Wettorp in einen noch nie dagewesenen Rausch und Jubel versetzte. Schon am Abend vorher, am[11] Freitage, kamen die fremden Gäste, denn die ganze Umgegend war eingeladen. Die Straßen waren schön geschmückt, Girlanden hingen quer von Haus zu Haus, und unter ihrer Mitte schwankten bemalte Tafeln mit sinnigen Kernsprüchen.
Am Sonnabend, morgens um 6 Uhr, zog der Ortsmusikus mit seinen Trommlern, Bläsern und Klarinettisten durch die Straßen des Ortes; das war der »Weckruf«, wie es im Programm hieß. Die braven Kriegervereinsmitglieder ärgerten sich zwar über das frühe Getute, aber ohne Reveille läßt sich ja nun einmal kein Kriegerfest feiern, und deshalb beruhigten sie sich und schliefen wieder ein.
Um 9 Uhr gab es eine große Sehenswürdigkeit: der Neustädter Militärverein hielt nämlich seinen Einzug. Er hatte seine eigene Kapelle mitgebracht, die der Ortsmusikus allerdings als eine Gesellschaft Bremer Stadtmusikanten bezeichnete; aber es war doch etwas besonderes, was sich die Neustädter leisteten, und die Militärvereinsmitglieder blickten stolz um sich herum, während sie im strammen Takte vorwärts marschierten. Sie hatten wahrhaftig auch alles Recht, stolz zu sein, denn außer der Musik trabten vor ihrem Zuge noch drei feurige Rappen, auf denen Herolde saßen. Diese drei Männer hatten sich großartig bunt kostümiert und wilde Bärte ins Gesicht geklebt, die freilich immer herabfielen, weil[12] sich der Gummi vom Schwitzen auflöste. Aber wenn auch die Bärte so oft auf ihren Sattel niedersanken, daß sie sie schließlich beiseite unter das Volk warfen: Herolde waren sie deshalb doch mit ihren Heroldsstäben in der Hand, den grauen Schlapphüten auf dem Kopfe, den Wappenwämsern um die Brust und den hohen Stiefeln an den Beinen. Sie fühlten ihre Würde und stützten ihre Stäbe in die Seiten, wie sie es wohl im illustrierten Sonntagsblatte bei Bildern von Königen gesehen hatten.
Ihre Pferde waren nicht minder frohgemut, daß sie heute, anstatt den Roggen einzufahren, als edle Araber durch Wettorps Straßen hindurch angestaunt wurden. So achtunggebietend zog der Neustädter Militärverein in den Festort ein.
Im Laufe des Sonnabendmorgens versammelten sich also wohl an die vierhundert Krieger in Wettorp, alte und junge, und die alten trugen ihre Zylinder vom Jahre 1848. – Um 11 Uhr begann der »offizielle Frühschoppen mit Musik« im Landhause. Der Ortsmusikus ließ blasen, was die Trompeten halten konnten; er hatte ein außergewöhnlich patriotisches Programm zusammengestellt, das denn auch von den Kriegern vollauf gewürdigt wurde.
Währenddessen war die kleine Mieze Stamm, des Landhauswirts Tochter, die dazu auserkoren war, als Germania bei der Denkmalsenthüllung[13] das Festgedicht zu sprechen, in ihrem Stübchen sehr beschäftigt. Schon um 12 Uhr hüllte sie sich unter dem Beistande der Wirtschafterin in den weißen Germania-Mantel, den sie sich selbst zurechtgeschneidert hatte; sie ließ sich frisieren mit Locken an den Seiten, und die Flut des lichten Haares fiel wellig über ihre Schultern. Dann wurden die bis zum Ellenbogen freien Arme mit goldenen Armbändern aus poliertem Messing geschmückt, und auf das Haupt drückte ihr die Wirtschafterin das Diadem mit dem größten und buntesten Edelsteine, der aus der Maskengarderobe zu entleihen gewesen war. Majestätisch sah die kleine Mieze aus, und sie freute sich auch erst ihres Spiegelbildes; aber dann kam die Angst über sie, und bleich und zitternd ging sie umher und murmelte immer und immer wieder, daß nun der schöne Tag gekommen sei. Essen konnte sie nichts.
Genau um ein Viertel vor drei Uhr fuhr der alte Kutscher Engel mit seiner Kalesche vor, und tief aufseufzend, mit einem Stoßgebet an den lieben, lieben Gott, stieg die Germania in den Karren, der sie zum Richtplatze führen sollte. Sie kam auf dem Markte an, wo es schon ganz voll von Leuten war, und wurde vom Ortsvorsteher sogar dem Herrn Geh. Regierungsrat v. Zabrowski und dem Herrn Regierungsassessor v. Schmidt vorgestellt, die[14] die allergnädigste Miene machten, weil sie doch bei der Denkmalsenthüllung die Vertreter der hohen Regierung und des Kaisers bildeten. Der Regierungsassessor konnte es sich freilich trotz seiner hohen Würde nicht versagen, nach Miezes rundem Arm zu schielen. Der Geh. Regierungsrat indessen war ganz nur Vertreter Seiner Majestät. Die hohen Herren, der Ortsvorsteher, die Gemeinderäte, die Schulbehörde und die Geistlichkeit, die Herren vom Komitee und Mieze Stamm stellten sich unter dem Thronhimmel auf, der dem noch verhüllten Denkmal gegenüber erbaut war. Der Thronhimmel bestand aus vier Stangen, über die oben Leinwand gezogen war, und das ganze hatte Gärtner Meyer mit Laub bewunden.

Der Ortsvorsteher blickte prüfend in die Runde, ob auch alles in Ordnung sei. Rings auf dem Markte, in einiger Entfernung von dem Denkmal, hatten sich die Kriegervereine aufgestellt, die Fahnen wehten über den Zylindern der Kameraden. Links von dem Thronhimmel standen die vereinigten Gesangvereine, und alles war so ruhig und feierlich, daß es dem Ortsvorsteher ordentlich zu Herzen ging. Er hatte seinen Hochzeitsfrack heute nicht umsonst angezogen, das fühlte er deutlich. Er sah also in die Runde, und sein Blick fiel auch auf die zwei Sitzreihen, rechts vom Denkmal, auf denen[16] die Honoratiorenfrauen des Ortes in ihrem besten Staate saßen, und auf den alten Orts- und Polizeidiener Pilgerim, der da stand und die Schnur hielt, mit der die Hülle des Denkmals nach oben zusammengerafft wurde. Alles war in Ordnung. Der Ortsvorsteher nahm seinen Zylinder ab, rieb sich mit dem Taschentuche die Tropfen von der Stirn, trat vor und verbeugte sich nach der Seite, auf der sich die hohen Herren befanden. Der Geh. Regierungsrat nickte, der Ortsvorsteher winkte den Sängern, der Ortsmusikus, der alles einübte, was in Wettorp an Gesang- und Orchesterkunst geleistet wurde, hob den Taktstock, und es ertönte prachtvoll: »Seht den Sieger …«
Alle waren ergriffen. – Als der Gesang sein Ende gefunden hatte, verbeugte sich der Ortsvorsteher wieder, wischte sich nochmals die Stirn und begann seine Festrede: daß er die hohe Ehre habe, die Vertreter Seiner Majestät unseres allergnädigsten Kaisers und einer hohen Regierung untertänigst und ehrfurchtsvollst zu begrüßen, und daß es eine hohe Ehre für den Ort sei, einen solchen Tag feiern zu können. Er wies hin auf die zusammengeströmten Scharen der ehemaligen Krieger, und angesichts dieses Denkmals fordere er sie alle auf, den Treueschwur zu erneuern für Kaiser und Reich. Er schloß damit, daß er die hohen Vertreter einer hohen[17] Regierung bat, Sr. Majestät den Ausdruck der unwandelbarsten Liebe Wettorps zu überbringen.
Der Geh. Regierungsrat trat nach dieser Rede vor, nahm den feinen Hut ab, steckte einen Augenblick den zweiten und den mittleren Finger zwischen den obersten und den zweiten Frackknopf und fing nun an: »Mein lieber Herr Ortsvorsteher! Verehrte Festgenossen und Kameraden! Als Vertreter der Regierung Sr. Majestät unseres allergnädigsten Kaisers, Königs und Herrn bin ich hierher gekommen, um an dem nationalen Ereignisse, das dieser Tag für Wettorp darstellt, teilzunehmen. Es hat die hohe Staatsregierung mit außerordentlicher Befriedigung erfüllt, daß nun auch in Wettorp durch das einmütige Zusammengehen aller gutgesinnten Bürger ein Denkmal für seine hochselige Majestät Kaiser Wilhelm den Großen errichtet werden konnte. Der Opfersinn der Bürger ist der beste Beweis dafür, daß der Geist des Umsturzes (er sprach das Wort mit harter, erhobener Stimme, und der Regierungsassessor runzelte finster die Stirn dabei), daß dieser Geist der Vaterlandslosigkeit und der Verachtung alles Ehrwürdigen und Großen keine Stätte in Ihrer blühenden Ortschaft gefunden hat. Möchte es so bleiben! Möchten Sie sich stets bewußt sein des innigen Zusammenhanges zwischen der Krone und dem Staatsbürger,[18] jenes Zusammenhanges, der Preußen groß gemacht hat und der jetzt auch diese Provinz mit seinem Segen überströmt. Ich sehe hier die tapferen Veteranen, die in den Schlachten gestanden und dem Tode getrotzt haben für die Freiheit Schleswig-Holsteins, ich grüße diese Männer, die für die edelsten Güter ihres Vaterlandes alles hinzugeben bereit waren. Wenn ich daher meiner leider notwendigen frühen Abreise wegen schon jetzt dem festgebenden Vereine, dem Kriegervereine für Wettorp und Umgegend, meine aufrichtigsten Glückwünsche zu seiner zwanzigjährigen Stiftungsfeier ausspreche im Namen einer hohen Staatsregierung, so bin ich mir bewußt, daß solche Glückwünsche an keiner besseren Stätte zum Ausdruck gebracht werden können, als an dieser, wo, jetzt noch verhüllt, bald aber als ein glänzendes Wahrbild des Patriotismus, das Kaiserdenkmal aufragt. Halten Sie fest, das bitte ich Sie in dieser erhebenden Stunde, an dem nationalen Gedanken, seien Sie eingedenk des hohen Berufes, den die Kriegervereine zu erfüllen haben: ein Bollwerk zu bilden wider die Macht eines unterminierenden, destruktiven Geistes (das kam wieder mit erhobener Stimme heraus, und der Regierungsassessor, der so lange auf Miezes Arme geblickt hatte, reckte sich hoch auf und zog die Brauen drohend zusammen). Mögen Sie noch[19] oft Ihr Stiftungsfest im Kreise Ihrer anderen Kameraden von nah und fern so schön und von allen Umständen so begünstigt begehen wie heute. Das sind unsere Glückwünsche. – Jetzt aber (er trat weiter vor, und der Regierungsassessor blieb immer einen Schritt hinter ihm) lassen Sie uns die Hülle von dem Denkmal gleiten sehen (Ortsdiener Pilgerim faßte das Tau fester und sah unverwandt zu seinem Vorgesetzten, dem Ortsvorsteher, hin), mit dem Gelöbnis, daß wir nie vergessen wollen, was Kaiser Wilhelm der Große für uns und besonders für unsere engere Heimat getan hat und gleich ihm sein erhabener Enkel, unser allergnädigster Kaiser, König und Herr. Wir fassen daher alle unsere Hoffnungen, alle unsere Gefühle, unsere ganze vaterländische Gesinnung in dem Rufe zusammen (der Ortsvorsteher erhob den Zeigefinger, Ortsdiener Pilgerim paßte mit allen Seelenkräften auf): Se. Majestät unser allergnädigster Kaiser, König und Herr – Hurra! Hurra! Hurra!«
Ortsdiener Pilgerim riß an der Schnur, so stark er nur konnte, die Leinewand flog davon, und im Sonnenschein grüßte die eherne Büste mit dem mildig ernsten Gesichte des alten guten Kaisers von dem blanken granitenen Sockel herab. Die Musik blies Tusch auf Tusch, die alten und jungen Männer riefen Hurra, die Hüte waren von den Köpfen gerissen.[20] Die Frauen waren aufgestanden und schwenkten ihre Tücher, die Fahnen wehten.
Dann stimmte der Ortsmusikus an: Deutschland, Deutschland über alles, und alle sangen voll wahrer Inbrunst mit; die Frauen weinten vor Rührung. Und alle blickten auf zu dem neu enthüllten Bildwerk. Am lautesten aber sangen hinter der festlichen Schar die Wettorper Jungen, die vorhin schon ein ganz gewaltiges Hurrageschrei angestimmt hatten.
Der Ortsvorsteher atmete auf, daß alles so gut gegangen war. Er hatte immer gefürchtet, Ortsdiener Pilgerim möge nicht schnell oder stark genug ziehen oder das Tau möchte sich verwickeln, oder es möchte sonst irgend etwas geschehen, was die Feier störte.
Als der Gesang verklungen war, trat die kleine Germania-Mieze, die auch so gerührt war von den schönen Reden und von des alten Kaisers freundlichem Gesichte, erst ein wenig zaghaft, dann aber tapfer vor und deklamierte ihr Gedicht. Und es klang so brav, wie die Kleine es hersagte in ihrer natürlichen, herzlichen Weise, und sie legte den Ton auch immer auf die Hauptstellen, und andächtig lauschten alle rings im Kreise auf Kaiser … Reiser … Gut und Blut … Todesmut … Vaterland … Herz und Hand. – Mieze kam so[21] in Begeisterung bei ihrem Sprechen, daß ihre frischen Wangen glühten. – Am Ende ihres Gedichtes legte die Germania einen hübschen Lorbeerkranz mit blau-weiß-roter Schleife am Fuße des Denkmals nieder und knickste zierlich, als der Geh. Regierungsrat zu ihr kam und ihr die Hand gab, um sie zu beglückwünschen zu ihrem schönen Erfolg. Auch der Regierungsassessor bekam ein Patschhändchen ab.
»Gnädiges Fräulein,« sagte er, – »geradezu tadellos, ein–fach ta–del–los.«
Noch aber war nicht alles zu Ende. Der Geh. Regierungsrat winkte dem gallonierten Diener, der sich so lange ganz beiseite gehalten hatte, und der brachte ihm drei kleine Etuis. Der Regierungsrat, auf dessen eigener Brust fünf Orden funkelten, hielt nun eine kurze Ansprache, in der er betonte, wie sehr es ihn freue, auch der Überbringer mehrerer allerhöchster Auszeichnungen zu sein. Und dann überreichte er dem Ortsvorsteher den Kronenorden vierter Klasse und teilte ihm gleichzeitig mit, daß ihm der Titel Bürgermeister verliehen sei; dem Wettorper Kriegervereine hatte der Kaiser einen Fahnennagel gestiftet, und Ortsdiener Pilgerim erhielt das allgemeine Ehrenzeichen in Gold. Der neue Bürgermeister machte bei seiner Auszeichnung ein ernstes Gesicht und antwortete nur ein paar[22] stotternde Worte: wäre sein Kaiser dagewesen, so hätte er ihm stumm die Hand gedrückt, so mächtig wirkte die Ehre auf den einfachen Mann. Der Vorsitzende des Kriegervereins hielt den Fahnennagel in der Hand und zeigte ihn all seinen Nachbarn, und Ortsdiener Pilgerim glänzte. Nun löste sich die strenge Ordnung, und es gab ein großes Gratulieren und Händeschütteln. Der Herr Geh. Regierungsrat und der Regierungsassessor verabschiedeten sich, nachdem sie das Denkmal eingehend gemustert hatten, und fuhren, vom Bürgermeister begleitet, zum Bahnhofe, denn sie mußten heute abend in Kiel sein; Se. Exz. der Herr Kultusminister Dr. Bosse kam abends. Damit war denn die Denkmalsenthüllung vorbei.
Auf dem Markte ordneten sich währenddessen die Vereine wieder und zogen zum Landhause. Da war im Garten großes Konzert, die vereinigten Gesangvereine trugen ihre Weisen vor, und die Kameraden saßen alle beisammen mit Frauen und Kindern und waren so recht von Herzen vergnügt und zufrieden. Damit ging der Nachmittag hin, und am Abend nach neun Uhr, als es schon dunkel war, brannte Apotheker Juliussen das große Extra-Brillantfeuerwerk ab. Wie die Feuerräder zischten und wirbelten, wie die pots à feu knallten, wie die Schwärmer knatterten und die Goldregenspringbrunnen funkelten.[23] Nur mit den Raketen wollte es nicht immer recht gehen, und jedesmal, wenn eine hochging, bliesen die Musikanten mit verstärktem Pust, damit die Raketen mehr Schwung bekämen. Und das Blasen half auch wirklich manchmal.
»Fihtz,« sagte die erste Rakete, und dann ging sie oben aus; »Ffiehtz,« sagte die andere und stieß mit dem Kopfe gegen einen Baumast, daß es knallte; »Ffi-i-htz,« sagte die dritte und richtig: »knatter, knatter, knatter« hörte man in der Luft, und rote, grüne und weiße Leuchtkugeln bubbelten heraus und sanken im Bogen langsam herab, bis sie verglommen. – »Oh,« sagten ringsum die Veteranen und die Veteranen-Frauen und -Kinder, »wie herrlich!« – Die Musik war stolz auf ihren Erfolg, denn sie war es gewesen, die dieser Rakete gerade zur rechten Zeit den nötigen Auftrieb verliehen hatte. Und deshalb paßte sie nun erst recht auf.
»Fiehtz-z-z-tz,« sagte die vierte Rakete, und »tschinkte« machten die Musiker gleichzeitig, und siehe da: das Wunderwerk zerteilte sich im Äther, und eine goldene Flut rieselte hernieder. »Oh,« sagten die Veteranen und die Veteranen-Frauen und -Kinder, »das war aber wirklich wieder herrlich!«
»Fitzefitzefitz,« sagte die fünfte Rakete, und »tschumbdi« ließ die Musik sich im rechten Augenblicke vernehmen, während die Pauke auch noch ihr[24] Besonderes tat und »plumm« machte, und wahrhaftig, es half wieder, denn »sisisisi« tönte es von droben herab, und singende Sternlein schwebten am Himmel.
»Nein doch!« sagten die Veteranen und die Veteranen-Frauen und -Kinder. »So was haben wir denn doch noch nicht gesehen!«
Dann sagten noch ein paar Raketen »fihtz«, und die Musiker bemühten sich redlich, sie ordentlich hoch zu bringen mit tschumbdi, tschintata und plumm, – meist gelang es, bisweilen kamen sie aber mit ihrer Aufmunterung auch etwas zu spät.
Schön war es aber eigentlich immer.
Und am nächtlichen Firmament blinkten traurig die armen natürlichen Sternlein, die nicht gegen Apotheker Juliussens Feuerwerk aufkommen konnten.
Den Schluß bildete die Erstürmung von Alexandria, – die war ordentlich beängstigend, denn es knallte und fauchte und zischte und sprühte durcheinander, daß einem schier schwindelig wurde. Dann kamen drei Kanonenschläge, bei denen die Veteranen von der Artillerie an ihre alten Hinterlader dachten und die Frauen und Kinder »Uhch!« schrien, und endlich wurde der ganze, durch Papierlaternen erhellte Garten mit bengalischen Flammen in rotes und grünes Licht getaucht.
»Ah, nein doch! So furchtbar hell!« sagten die Veteranen und die Veteranen-Frauen und -Kinder.
Dann ging es heim, nachdem die vereinigten Gesangvereine noch voll tiefer Empfindung: »Gute Nacht, gute Nacht, mit Näglein bedacht« gesungen hatten. Die Gäste begaben sich in ihr Freilogis bei den Wettorper Kameraden oder zu den Massenquartieren, die im »Blauen Löwen« und im »Landhause« hergerichtet waren.
Der neue Bürgermeister gab seiner Frau vor dem Zubettgehen einen herzlichen Kuß und meinte: »Siehst du, Dora, – unser Kaiser – das is 'n Mann, den muß man achten.«
Und der Tag war so schön verlaufen, wie überhaupt nur das zwanzigjährige Stiftungsfest eines Kriegervereins und eine Denkmalsenthüllungsfeier verlaufen kann.
Am Sonntagmorgen fand Konzert auf dem Eichenberg bei Wettorp statt, und nach dem Kirchgange wanderten die Kameraden erst ganz gemütlich durch die Straßen. Die Musik, die am frühen Morgen vom Kirchturm herab Choräle geblasen hatte, spielte von zwölf bis ein Uhr auf dem Markte vor dem Denkmal, das weidlich angestaunt ward, und als sie geendet hatte, da traten die Vereine zum Festzuge an. Knaben mit Tafeln, auf denen die Ortschaften der verschiedenen Vereine geschrieben standen, stellten sich in bestimmter Entfernung hintereinander auf, und bei ihnen versammelten sich die Mitglieder.[26] Bald war der ganze Markt voll. Der Vorsitzende vom Wettorper Kriegervereine kommandierte: »Stillgestanden!« und die Alten nahmen ihre Arme fest zusammen und machten ein Dienstgesicht, so gut es noch anging. Der Vorsitzende befahl: »Fahnensektionen – vor! Fahnen holen!« und von jedem Vereine schritten drei Männer ins Rathaus, um die Wahrzeichen an sich zu nehmen. Der Ortsmusikus paßte mit erhobenem Taktstocke auf, und sobald die erste Fahnenspitze sichtbar wurde, senkte er den Stab, und »tra–tatata–diida« ging es los, während alle Veteranen und Kameraden den Kopf entblößten, bis die Fahnen sich eingereiht hatten. Die Musik stellte sich nun an die Spitze des Zuges. »Bataillon Marsch!« hieß das Kommando, und der Festzug setzte sich in Bewegung. Die Kameraden hatten alle ihre Orden und Ehrenzeichen angelegt, und die blinkerten goldig im warmen, lustigen Sonnenscheine. So marschierten sie durch die Straßen; aus den Fenstern warfen ihnen Frauen und Mädchen kleine Sträuße und einzelne Blumen zu, die die Vorübergehenden mit ihren verarbeiteten Händen auffangen sollten, aber sie waren zu ungeschickt dazu, und die Blumen fielen zwischen den gespreizten Fingern hindurch zur Erde, um von den Hinterleuten halb zertreten aufgehoben zu werden. So pilgerten die Alten[27] hinter der Musik und den wehenden Fahnen her und gaben sich bisweilen einen Ruck, wenn der Ortsmusikus ein recht forsches Stück spielen ließ, das sie wohl anno 1848 oder 1870 schon gehört hatten.
Zu beiden Seiten des Zuges aber standen die Wettorper, Frauen und Männer, dichtgedrängt, ließen alles vorbeimarschieren und eilten dann schnell durch eine Querstraße bis dahin, wo sie den Zug später wieder sehen konnten.
»Tschingda tschingda dudeldudeldudel bumm,« machte die Ortskapelle und so gelangten alle ins Landhaus, wo das Festessen stattfand. Das war nun ein wahrer Hochgenuß. Königinnen-Kraftsuppe mit Fleischklößen und Spargel gab es zwar nur wenig auf den Tellern, denn wenig Suppe geben ist vornehm, die Butten mit der Mehlsauce waren schon kalt, aber das kam nur daher, daß sich der Festzug um eine halbe Stunde verspätet hatte und daß so viele mit essen wollten, die sich vorher nicht angemeldet hatten. Das Roastbeef dagegen war nun wunderbar zart. – »Ja,« sagten die Wettorper, »Fru Stamm weet, wo 'n Stück Ossenfleesch bradn wardn mutt. Na, un de Sohs' de mugg man ja rein mit Lepeln eten.« Und alles, was dann noch kam, Früchte, Brot, Butter und Käse, war gut und reichlich, und das Eis war nicht zu kalt. Nein, für zwei Mark »das trockene Kuvert« hatte[28] man da ein herrliches Essen. Und der Wein war auch so schön; je zwei Kameraden tranken meist eine Flasche.
»He farvt örntlich, – kick mal, wo rod min Glas is. Un denn is he bannig stark, aber wenn man twee Mark föftig för so 'n Buddel utgifft, denn will man em ock marken1 können. Junge, wat markt man em!«
Und Reden wurden gehalten. Erst auf den Kaiser, dann auf die Gäste, dann auf den Wettorper Verein, dann auf den Bürgermeister, dann auf das Komitee, dann auf die Frauen, dann auf Deutschland, dann auf Schleswig-Holstein, dann auf alle Kriegervereine, dann auf die deutsche Flotte, dann auf die Kaiserin, dann auf Mieze, dann auf alles Mögliche – – man konnte die Redner gar nicht mehr verstehen, so laut wurde es mittlerweile im Saale und so dicht war der Zigarrendampf. Wenn aber einer sein Glas erhob und hoch! hoch! hoch! rief zum Zeichen, daß er mit seiner Ansprache zu Ende war, so erhoben sie alle die Gläser mit und riefen alle mit hoch! hoch! hoch! – Es war auch einerlei, meinten sie, auf wen das Hoch ausgebracht wurde: zugute mußte es ihm ja unter allen Umständen kommen, wenn sie nur kräftig mitschrieen. – Die Ortskapelle musizierte auf der Tribüne und[29] spielte ein patriotisches Potpourri nach dem andern, und sie sangen alle mit »lalala,« denn den Text kannten sie nicht oder doch nur die erste Strophe jedes Liedes.
Natürlich waren hier nur die Herren versammelt; die Damen tranken während des Festessens ihren Kaffee im Garten und blickten wohl einmal durch die Saalfenster, ob ihre Männer es auch nicht zu arg trieben; aber die fühlten sich sicher und ließen sich weder durch Winke noch durch Blicke davon abbringen, sich noch eine Flasche Rotwein mit ihrem Nachbar zu teilen.
Um sechs Uhr erst wurde der Saal geräumt, und in einer halben Stunde war alles, was an das Essen erinnerte, beseitigt. Das Trompetensignal, der Ruf zum Sammeln, ertönte, die Veteranen mit den Ihrigen strömten wieder herein, wunderten sich, daß alles so schnell verändert war, und setzten sich erwartungsvoll hin mit dem Gesichte zur Bühne gewandt, wo das Festspiel aufgeführt wurde.
So schönes Theater hatten die Kriegsveteranen und Kameraden nie gesehen. Als der Vorhang nach dem rührenden bengalischen Lichte und nach dem herrlichen lebenden Bilde fiel, da klatschten sie, was sie nur klatschen konnten.
Und dann begann der Kommers. An vier langen Tafeln, ebenso wie vorhin beim Festessen, hatten[30] die Kameraden Platz gefunden, und lustig flogen die Worte hin und her.
Die Lieder waren alle in Reihenfolge, wie sie gesungen werden sollten, auf ein Blatt gedruckt, und ganz zum Schlusse stand auch »Schleswig-Holstein, meerumschlungen«. – Und niemand wußte recht, wie es eigentlich kam, – eben war die Wacht am Rhein verbraust, und es sollte nun »Wohlauf, ihr wackeren Kameraden« kommen, – aber auf einmal ertönte, als hätte man sich vorher dazu verabredet, außer der Reihenfolge der Anfang des Schleswig-Holstein-Liedes, – erst hier und da – ein paar alte schleswig-holsteinische Lehrer mochten damit angefangen haben, dann fielen immer mehr und mehr ein, die Musik mußte sich dem allgemeinen Willen fügen, die alten Kämpen erhoben sich von ihren Plätzen, stützten die Hände auf den Tisch, blickten in die Höhe mit begeisterten Augen und es klang:
Und es kam eine Kraft über sie, wie damals, als sie für die Freiheit ihrer Heimat ins Feld zogen, als die Hand den Säbel fest umfassen und das Auge die Büchse scharf richten konnte.
Ihre Stimme zitterte bei diesen Klängen; die hohe Wacht, die hatten sie einst gehalten und deutsch waren sie gewesen bis in ihr innerstes Mark hinein.
Und sie dachten an alles Schwere, was sie durchgemacht hatten in Kampf und Sturm, und an die Sorgen, die sie einst für die Ihren daheim im Herzen getragen hatten. Und es war wie ein schmerzliches Zucken um ihre Mundwinkel, als die Alten so da standen, die Blicke aufwärts und die Hände auf den Tisch gestützt.
Ja, jetzt war alles ganz anders gekommen, als damals, wo sie um ihre Freiheit streiten mußten. Freilich, ihr Herzog war ihnen genommen, aber ihre Herzogstochter, die war jetzt deutsche Kaiserin. Es hatte schön getagt auf die Nacht des Kampfes.
Alle fühlten sie sich als Brüder, so innig miteinander verwoben, und sahen einander in die Augen, wie sie das sangen, und Tränen blinkten darin, und sie nickten einander zu mit den braven, geraden Gesichtern.
Sie hoben die Gläser, die Alten und die Jungen, und stießen an und schüttelten einander die Hände und waren einander gut und umarmten die Kameraden. Und dann wiederholten sie die beiden letzten Zeilen:
Und als diese einfachen Veteranen das Wort »Vaterland« aussprachen, so ernst begeistert, so innig trotz der Rauheit der Stimmen, da lag für die Jungen im Saale das Geheimnis geoffenbart, warum wir jetzt ein einiges Deutschland haben!
Das war das Kriegerfest in Wettorp.

Für Anna Croissant-Rust, die am 10. Dezember 1860 in Dürkheim a. d. Haardt geboren und in München-Pasing wohnhaft ist, lassen sich drei Stufen künstlerischer Entwicklung feststellen. Ihre ersten »Lebensstücke« und Volksdramen sind im Grundton herb, brüchig, grell, aber bereits bewundernswert in ihrer Objektivität und klugen Beobachtung. Ihre »Gedichte in Prosa« verraten ein durchaus eigenes lyrisches Talent, das um seine Form ringt. Danach aber kommt es wie eine innere Befreiung über die Dichterin: wo vordem nur einzelne heitere und ironische Lichter spielten, da bricht jetzt die Sonne des Humors durch und steht sieghaft und erwärmend über den Härten und Unverständigkeiten des Alltags. Keiner unter den heutigen Künstlern hat aus eingeborener tragischer Grundstimmung heraus so ernst und schwer um sein bißchen Heiterkeit und Lebensfrohsinn gerungen wie diese herbe und doch zutiefst herzensgütige Frau. Mag Anna Croissant-Rust von Menschen oder von Tieren erzählen, mag sie uns nach der Pfalz oder nach Tirol führen, mögen die[35] Leutchen ihrer Geschichten in der Kleinstadt die Köpfe zu aller Narretei zusammenstecken oder auf den verschneiten Einödshöfen der Berge gegen die Härte der Natur und des Herzens ankämpfen: immer erhebt uns die tapfere Hand der Dichterin aus den Niederungen des Lebens in die reine Luft geläuterter Menschlichkeit.
L. Adelt.

Der Herr Buchhalter.
Jeden Mittag und jeden Abend sitzt er in der Post. Er kennt kein anderes Wirtshaus, hat den Fuß nie in ein anderes gesetzt. Nicht etwa, weil sie schlechter sind, davon weiß er nichts; aber er ist ein Mann von Charakter. Hat er einmal angefangen, sein Mittagmahl und sein Abendessen in der Post zu nehmen, so bleibt's dabei, das gehört sich; unnötige Veränderungen in der Lebensweise sind nur Schwächen, wert eines Lächelns. Konsequent muß man sein!
Er hat seinen Stammtisch, seinen Stammplatz, sein Stammkrügel, sein Stammglas, seinen Stammserviettenring und – wehe der Kellnerin, die ihm einmal im Drang der Geschäfte etwas anderes vorzustellen oder vorzulegen wagte! Den Wechsel der Kellnerinnen hat er noch stets dem Wirt als persönliche Beleidigung angerechnet, und so unbefangen ihm jede »Neue« entgegentrat, so befangen war der Wirt, so befangen wurde auch bald die Neue. Das war doch wohl die größte Rücksichtslosigkeit! Hatte man so ein Frauenzimmer jahrelang[37] erzogen, und wenn sie sich dem Ideal nun etwas näherte, schickte man sie ihm vor der Nase fort.
In den zwölf Jahren, seit er hier aß, war das schon sechsmal geschehen. Die immerhin freundschaftlichen Beziehungen, die er mit dem Wirt unterhielt – sie grüßten sich stets beim Kommen und Gehen –, wurden dadurch erheblich getrübt, und es dauerte immer ein Vierteljahr, bis er den Gruß des Wirtes wieder sah.
Draußen in der großen Kunstmühle, die der schnell rauschende Silberbach trieb, war er seit zwölf Jahren Buchhalter, dort wohnte er, und nur des Mittags, Sommer wie Winter, bei Schnee und Regen und Sonnenschein, erschien er fünf Minuten nach zwölf auf der Post, und des Abends fünf Minuten nach sieben.
Er war ehemaliger Soldat, – er behauptete Leutnant, die Bauern Feldwebel – und hatte sich beim Manöver eine Verletzung zugezogen, die ihn dienstuntauglich machte. Noch jetzt schleppte er den einen Fuß etwas nach, und die Schmerzen, die ihm der Witterungswechsel brachte, veranlaßten ihn immer zu lauten Ausbrüchen über die unsinnige Soldatenschinderei, die nur den Preußen zu verdanken sei. An den alten Soldaten erinnerte außer dem kleinen, etwas borstigen Schnurrbart, der in zwei fest gezwirbelten Spitzen auslief, nichts als[38] das kurzgeschorene Haar und die rotbraune, etwas cholerische Gesichtsfarbe. Er war mittelgroß und eher schmächtig, schwarz von Haar und Bart, mit kleinen, etwas gewölbten, stechenden, dunkeln Augen.
Wenn er so am Kopfende seines Tisches saß, die Zigarre, die er stets in einem Röhrchen rauchte, nach oben gestemmt, die Unterlippe vor- und aufwärts geschoben, die beiden Arme aufgestützt, und über den Tisch blickend, so sah er niederschmetternd selbstbewußt aus.
Mit ihm aßen ein paar Adspiranten2 der kleinen Bahnstation, ein junger Schreiber und der unverheiratete Bahnmeister. Doch stets blieben die beiden Stühle rechts und links vom Herrn Buchhalter leer, das war der Brauch von Anbeginn gewesen, und daran durfte nicht getippt werden. Während der Mahlzeiten hatte der Tisch zu schweigen, das heißt, er sprach nicht und verbat sich auch nachdrücklich eine lautere Unterhaltung. So wurde also am Tisch unten nur gewispert, man bot sich mit stummem Nicken die Platten und begehrte säuselnd nach Brot und Bier. Wie ein frischer Wind wehte in diese gedrückte Atmosphäre stets die resche Art einer neuen Kellnerin herein, die mit voller Naivetät und, der Pflichten ihres Amtes bewußt, die Herrn zum »Dischkriern« animieren wollte, und voll Heiterkeit[39] mit ihrer Unterhaltungsgabe wie eine Fregatte mit vollen Segeln an dem Tisch landete. Zuerst legte er die Zigarre weg; dann stemmte er den linken Arm ein, seine blanken, kleinen Augen fuhren wie Blitze hin und her, und alsbald brach auch schon das Donnerwetter los.
»Jetz' schaugt's ma dö an! Na, frei' di' ner3, Madl, i' werd' dir Mores lehren! So a G'schroa machen! Du ungebildete Bersohn! Wos? – Stad bist! Ball4 i' red', hot a jed's stad5 z' sein, verstanden?« – Eine einzige hatte es je gewagt, ihm sofort prompt zu erwidern, beide Arme einstemmend und ihn auch gehörig anblitzend: »Jö, schaugt's den an, den z'widern Raunzer6! I' tua, wos i mog, und von dir laß i' mir nix anschaffen.«
Aber sie wurde augenblicklich von der Strafe ereilt. Mit einem Satz war er in der Höhe, und so sehr sich die im übrigen Handfeste wehrte, hatte er sie mit einem einzigen Griff beim Halse gepackt und hinausgedreht. Da er kleiner war als sie und bei der Prozedur verschiedene Tritte und Püffe abkriegte, war es für die aller Pietät baren, frivolen Adspiranten eine solche Wonne, daß sie die Füße auf die Stühle zogen und sich in die Zunge bissen, um[40] nicht gerade herauslachen zu müssen, während der kleine Schreiber, der schon von Amts wegen darauf eingeübt war, lautlos grinste, und der Bahnmeister, etwas schwerfälligeren Temperaments, mit offenem Maul dem hochnotpeinlichen Halsgericht zusah.
Diese eine, die aller Tradition solchergestalt Hohn gesprochen, mußte auf kategorischen Wunsch des Herrn Buchhalters entlassen werden. Der Wirt leistete zu Anfang energischen Widerstand, denn alle übrigen Eigenschaften der Hebe standen ganz im Einklang mit ihrer Handfestigkeit und stempelten sie zum Ideal einer Kellnerin.
Aber der »Buachhalter« drohte, das Haus »nie mehr zu betreten« – es war eine der dramatischsten Szenen seines Lebens; schließlich war er der älteste Stammgast, der Wirt unterlag also der Übermacht seiner Persönlichkeit, achselzuckend und mit der Miene, wie man etwa einem ungezogenen Kinde nachgibt.
Am Stammtisch hatte die Sache ein Nachspiel, als der »Buachhalter« um die gewöhnliche Zeit verschwunden war. Alles ging da außer Rand und Band, »es lösten sich alle Bande frommer Scheu«, es war die reinste Meuterei.
Über den Wirt ging's her vorerst, denn die »Resche« hatte ihnen samt und sonders den Eindruck gemacht, wie wenn man sie unbedingt da[41] lassen müsse, und wenn's nur wäre, um ein Gegengewicht gegen »den da oben« zu haben.
»So a Hanswurscht, der Wirt! Na, so 'was! Aber gar koan Kurasch. Der hätt' i sein mög'n, i hätt' anderscht aufg'muckt. Herr di Gatti, dem hätt' i 's zoagt! Was is denn dös iwerhaupt's für a Wirtschaft? Is denn ner der da? Zahl'n mir unser Zeig net grad a so wie der? Wenn mir g'sagt hätten, mir möchten 's Madl b'halten, was er epper7 da g'macht hätt'!? Dös war' a Hetz' word'n! Mir derften uns schließli' nimmer z' schnaufen trau'n. War uns scho' z' dumm! Mir san a so viel wia der da herinnet, und mir leiden amal dös nimmer, jetz' muaß 's anderscht geh'n!«
So schrien und schimpften und brüllten sie durcheinander, schauten sich kampfmutig und mit roten Köpfen an und hieben auf den Tisch, daß die Gläser sprangen.
Da tat sich die Türe auf, der Herr Buchhalter erschien aufs neue, zwickte die Äuglein zusammen, und ein paar Hohnfalten liefen vom Mund abwärts, als er die aufgeregten »Mander« sah.
»Ös scheint's enk8 ja recht guat z' unterhalten!« sagte er in einem Ton, der, oberflächlich gehört, ans Väterliche gemahnte, für die Eingeweihten aber ein Sturmsignal barg.
Ruhig hängte er seinen Mantel an den Nagel, das Lodenhütl, das er immer etwas links trug, dazu, rückte sich den Stuhl zurecht und – setzte sich.
»I' hab' ja d' Innsbrucker heut no' net g'lesen mit der saudummen G'schicht',« sagte er.
Die »Mander« saßen stumm und stocherten in ihren Tellern weiter, die Augen fest auf die Überreste ihrer Mahlzeit geheftet.
»I' hab' heut d' Innsbrucker no' net g'lesen,« wiederholte er mit gehobener Stimme, und seine Gesichtsfarbe vertiefte sich um einige Nüancen.
Ein leises Gebrumm ging unter den Verschworenen herum, ein Räuspern – »Dort hängt s' ja, Sakrament!« schrie er und deutete an die Wand, wo sie über dem Kopfe des jüngsten Adspiranten hing.
»Jessas, was hast d' denn? So gib's eahm doch!« Und mit Reden und Stößen und Püffen wurde der Hartnäckige aufgemuntert, bis er sie dem vor Zorn Blauroten, der mit seinen bösen Augen förmlich auf ihn einstach, reichte.
So endete die so merkwürdige Verschwörung, und bis dato ist noch keiner gekommen, der den Bann gebrochen hätte, dem Milieu nicht unterlegen wäre.
Zwar gab es immer von Zeit zu Zeit einen neuen Adspiranten, und das war immer eine »Gaudi«9 für die Wissenden. Gewöhnlich setzte er[43] sich auf einen der leeren Stühle, fing als artiger Mann eine Konversation mit dem Ältesten der Gesellschaft an, also mit ihm, dem k. k. Feldwebel in Pension und jetzigen Buchhalter, ließ sich vielleicht durch sein erstes Gegengrunzen nicht einmal abschrecken und redete weiter – dann langte der Gewaltige gewöhnlich die größte Zeitung, die über seinem Haupte hing, herab, hielt sie vor sein Antlitz, daß oben nur das Ende seines Haarschopfes und das Ende seiner Zigarre herausragte. War der Kerl frech, so plapperte er weiter, bis ihm aus den Tiefen ein: »Halten's jetzt Eahna Maul oder nöt?« entgegenscholl – dann wagte er vielleicht noch ein: »Sie, aber erlauben's!« – »Nix erlaub' i, 's Maul habt's z' halten.« – War er nicht frech, so wandte er sich nach den ersten deutlichen Winken an die unten Sitzenden, um dort Unterhaltung zu suchen. Aber hier bekam er nur Kopfnicken, unartikulierte Laute und Achselzucken als Antwort, und seine Verwirrung, sowie das Gesicht, das über der Zeitung auftauchte und einmal mit den andern gemeinsame Sache machte, war ihre einzige Entschädigung und ihre einzige Rache. Deshalb wurde keiner eingeweiht.
Mit den Zeitungen hatte es auch seinen Haken. Er las sie genau der Reihe nach, und jedem Neuling passierte es, daß er in seiner Verlegenheit gewöhnlich[44] nach irgend einer dieser Zeitungen griff. Der Buchhalter las die seine ruhig weiter, bis die andere an die Reihe kam; dann sagte er gewöhnlich: »Erlauben's!« und nahm sie einfach dem Lesenden aus der Hand.
Protestierte der, so fielen die anderen über ihn her: »Sie kommt jetzt dran, lassen Sie's eahm doch, Sie können's ja später lesen!« Und der Herr Buchhalter bekam sie jedesmal, klein gekriegt hatte er noch jeden.
Vom Beginn des Essens bis zum Schluß las er. Er löffelte hinter der Zeitung seine Suppe, er stocherte mit der rechten Hand im Essen, links hielt er sein »Bladl« – er war kein großer Esser, aber Roten trank er gern und viel.
Nicht etwa, daß er während des ganzen Mahles geschwiegen hätte! Er liebte es, einige Pointen aus der Zeitung zuerst halblaut, dann ganz laut zu lesen, mit Bemerkungen wie: »Dös is do' zu narrisch, jetz' ham's im Landtag …« und er heischte Repliken von der Tischgesellschaft. Keinen Widerspruch, aber Anteilnahme. Fiel diese zu lahm aus, so rief er wohl: »Schlaft's denn heut alle? San dös Mannsbilder!« Auch die Neuigkeiten des kleinen Ortes stieß er unter dem Lesen hinter der Zeitung heraus, kurz, bissig, mit einem eigentümlich meckernden Lachen.
Er sah es als Beleidigung an, wenn der Tisch Neues wußte und nicht verriet. Wußten die »Untern« etwas, so fing ein leises Gesäusel am Tisch an, das ihn zuerst nicht irritierte, denn das kam, in schicklichen Grenzen, hie und da vor; aber wenn es vernehmbarer wurde, spitzte er die Ohren, und sein Schopf, das Ende der Zigarre und dann die Äuglein kamen nach und nach hinter der Zeitung zum Vorschein. Das war das Signal zum Ausbruch, und nun wollte jeder mit der Neuigkeit herausplatzen, bis er endlich einen direkt darum anredete. Dann war's aber immer noch kein leichtes; man mußte die richtige Form finden, witzig sein, besonders wenn es Weibergeschichten waren. Trug man die nicht gut vor, so raunzte er wohl: »Machen's an Spektakel wegen aner solch'n Bagadelln!«
Er war ein ausgesprochener Weiberfeind und sprach nur mit äußerster Verachtung von den Frauen. Zum Saubermachen, zum Putzen und »Nah'n« kann man sie brauchen, meinte er, »aber net amal 's Kochen verstehngen's – i mog mi net ärgern!«
Und als einmal ein Vorwitziger rief: »Aber 's Kinderbringen!« entgegnete er nicht ohne Würde: »O na, mei' Liaber, grad dös verstehngen heutigen Tags die wenigsten; drum, i sag's net umasunst, sie san verpfuscht um und um, und net der Müah[46] wert, daß d' über sie red'st.« Wußte er von einem der »Untern« etwa, daß er verliebt war, so war der vor seinen bissigen Bemerkungen nicht sicher; ängstlich hielten sie drum alles geheim, was mit der Liebe zusammenhing. Als der Bahnmeister sich verlobte, blieb er lieber von der Post weg, anstatt sich seinen Spötteleien auszusetzen, und ging in weitem Bogen um den »Pascha von der Mühle«, wie sie ihn unter sich nannten, herum.
Da rieb er sich schmunzelnd die Hände. Feiner und größer war noch keiner seiner Triumphe gewesen. »Secht's 'n?! – und solche Mannsbilder seid's allz'samm'!« Bei solchen Vorkommnissen liebte er es, weit über seine Zeit sitzen zu bleiben, und weit über sein Maß zu trinken, das immer sehr respektabel war. Der Zustand der Bärbeißigkeit schlug nach zwölf Uhr in den der Jovialität um; er erzählte mit halb krähender, halb kichernder Stimme, immer dabei die Zigarre mit der Spitze gen Himmel streckend, dem ganzen, vor Vergnügen wiehernden Gastzimmer alle möglichen Liebesgeschichten. Besonders die seiner Tischrunde. Es begann etwa mit: »Da sitzt a aso Oaner10«, und endete mit: »werd scho' 'no schaug'n, so a Gimpel, so a verliabter.«
In der Nacht hatte dann die Korona das Vergnügen,[47] ihn nach Hause zu geleiten, und es gehörte zur süßesten Erfüllung aller schlummernden Rachegelüste, wenn sie den Lallenden, Schimpfenden und Wankenden durch einen gelinden Stoß, den er in seinem Zustand nicht bemerkte, im Winter in den Schnee, im Herbst und Frühjahr in den Schmutz und im Sommer in den Staub werfen konnten. Niemals waren sie ausgesöhnter mit ihrem Schicksal, und niemals fühlten sie sich dem Pascha überlegener.
Singend, pfeifend und laut lachend zogen sie durch die Gassen, und sogar den nächsten Morgen hielt die Kampfstimmung noch an – es war beinah' wie zur Zeit der Saison, wo alle Bande auseinander gingen, wenn die Fremden kamen: wo sich die Unterschiede verwischten, die beiden Stühle nicht leer bleiben durften, wo sie alle eng gedrängt sitzen mußten und laut reden durften, so wie ihnen der Schnabel gewachsen war, denn in dem allgemeinen Geräusch ging das bißchen Lärm, das sie machten, so wie so unter.
Dann saß er am Tisch, förmlich gekauert unter der Zeitung. Nie warf er einen Blick vor, nie grüßte er jemanden, nie sprach er während der Zeit. Der Ingrimm häufte sich so in ihm, daß er sichtbarlich magerer wurde, nichts mehr aß und ganz gealtert aussah. O, wenn er sie alle hätte[48] vertilgen können! Alle, alle! Und jährlich wurden's mehr, und keiner war unter ihnen, der sich auch nur um ihn kümmerte! Er sehnte den September herbei, als die Zeit der Erlösung, und wenn der letzte den Rücken gekehrt, so rief er aus: »Is 's jetz' endlich dahin, dös G'sindel? Koan Respekt vor nix! Den anständigen Menschen d' Luft verpesten, 'n Platz versitzen und d' Ohren doret schrei'n, daß an andrer gar nimma aufkimmt! Und dös wollen gebildete Leut' sein? Pfui Teifel! Da san mir scho' andere, da herinn in die Berg'!«


Abseits vom Heer der modernen Literaten und Poeten steht Wilhelm Schussen, ein eigenwilliger und eigenartiger Kopf, ein Verneiner aller Gesellschaftslügen und aller Scheinwerte unserer Kultur, ein rarer Vogel, der seine »philosophischen Kuckuckseier« in das enge Nest der Konvention legt. Vor seinem ehrlichen und rücksichtslosen Suchertum fallen die Kulissen unserer öffentlichen und persönlichen Zustände; Heuchler und Schelme zu entlarven ist ihm ein grimmiges Bedürfnis. Fern allem Zelotismus und Pharisäertum aber bricht er nicht selbstzufrieden den Stab über den armen Sündern – was er will und dichterisch gestaltet, ist die sittliche Läuterung des irrenden Menschen. Eine kraftvolle, reiche und ungesuchte Sprache spiegelt seine kantige und starke Persönlichkeit. Gleich dem Vinzenz Faulhaber seines Schelmenromanes stammt Schussen aus dem Schwäbischen; er ist am 11. August 1874 in Schussenried geboren. Sein bürgerlicher Name lautet Wilhelm Frick in Fürstenfeldbruck bei München.
L. Adelt.

Pilgrime.
Da sah ich kürzlich in einer Sammlung japanischer Beinschnitzereien unter den vielen kunstvoll gearbeiteten Gegenständen auch ein entzückend hübsches elfenbeinernes Figürchen, das den schlauen Meister Reineke als Pilger darstellte, wie er, eingehüllt in einen Mantel und die mit dem Pilgerstab versehenen Hände vor dem Leibe gekreuzt, barfüßig auf dem Wanderwege Halt macht und sich eben wieder einmal umsieht, ob keine Augen in der Nähe wachen.
Er wird, das merkt man seinen Mienen schon im voraus an, sich herzlich satt lachen, wenn er sich unbehelligt weiß, oder er wird, sofern etwa eine alte Frau oder eine junge, die sich an seiner Gottseligkeit erbauen wollen, vorbeikommen, das Haupt noch tiefer herunterfallen lassen und die Züge noch mehr verklären und mit schönen Lichtern begießen.
Und jetzt fallen einem ganz von selber alle die alten Geschichten wieder ein. Und man denkt wieder sofort daran, wie der Spitzbube sich gar einmal als Beichtvater vermummte und im Dämmer der[52] Adventszeit einen Dom entheiligte und daselbst Männern und Frauen und Kindern und Nonnen und Kapuzinern die Beichte abnahm und eines jeden Gewissen erforschte und einem jeden seinen Zuspruch erteilte und von allen Sünden lossprach und eine gehörige Buße auferlegte. Es ist selbstverständlich, daß er so nebenzu auch an die eigene Seele dachte und die gute Gelegenheit nicht ohne Nutzen gebrauchen wollte. Befahl er doch einem bekannten Weinhändler, der immer den Wein verbesserte, weil ihm der Regen unseres Herrgotts nicht genügte, zur heilsamen Buße einen großen Korb Weintrauben bei Nacht und Nebel nach einem stundenweit entfernten Walde zu tragen und dort am Fuße der sogenannten Geistereiche niederzulegen. Auch forschte er einen reuigen Rentner, der ihm bekannte, er hätte bei einem Gansessen des Guten ein bißchen zu viel getan, so lange aus, bis er wußte, wieviel Gänse der Geflügelstall noch beherbergte und wann die Magd des Abends schlösse und des Morgens wieder öffnete. Es ist ja auch nichts Neues, daß er dann beim Bekenntnisse einer schon angejahrten Jungfer laut auflachte und die Füße unterm Rock vorstreckte und auf diese Weise entlarvt und vom Meßner fortgeprügelt wurde. –
Das sind die alten Geschichten, die, wie die hübsche Elfenbeinfigur bestätigt, auch den Japanern[53] und wohl auch anderen Völkern nicht fremd bleiben konnten. Solche Streiche hat nun der Schreinermeister Lorenz Daisenrieder nie ausgeführt. Das leuchtet ohne weiteres in die Augen.
Aber Schloßverwalter des Schlosses zu Wittenberg hätte er doch einmal gar zu gerne werden mögen und wäre es beinahe auch geworden, wenn jene unglückselige Wallfahrt, die hier erzählt werden soll, nicht so übel geendet hätte. Übrigens war wieder einmal seine Frau Mechthilde an allem schuldig gewesen. Das war so die Regel. Und er hätte es eigentlich wissen können.
»Lorenz,« hatte sie abends im Bett zu ihm gesagt, »wenn ich du wäre, Lorenz, tät ich schon lieber meinen Kopf durch ein Schloßfenster hinausstrecken als durch ein Schiebefenster, wo du ihn übrigens nicht mal durchbringst, weil er zu dick ist.«
»Drum hab' ich mich ja bereits an den Laden gelegt,« versetzte er, sich ein paarmal tüchtig rülpsend.
»Was heißt an den Laden gelegt? Mit dem An-den-Laden-gelegt ist noch nichts getan. Regen mußt du dich, Lorenz, wenn du es zu was bringen willst.«
»Petitioniert hab' ich,« sagte er darauf.
»Ach was, petitioniert,« sagte sie.
»Der Graf ist ein Esel. Ganz Wittenberg weiß es. Sonst tät er sich ein sauberes Weib ein und ließe es sich mit ihr wohl sein.«
»Die alte Schloßverwalterin habe nach dem Tode ihres Mannes ein Vermögen von dreißigtausend Mark fortgeschleppt, hört man,« erzählte Frau Mechthilde.
Daisenrieder richtete sich im Bett auf und sagte: »Das finde ich nicht 'mal so viel. Es wird sich einer doch auch noch ein paar Groschen ersparen dürfen, wenn er sich so und so lange abplagt.«
»Wieviel hast denn du schon erspart?« spottete sie, und es war gut, daß er ihr Gesicht nicht sehen konnte.
»Drum hab' ich ja auch petitioniert,« versetzte er ärgerlich. »Davon bist mir jetzt aber sofort still. Sag' lieber, auf welcher Geldbank hast denn du deinen Profit aufgehoben? Und hast auch dein Papier gut versorgt? Und bist auch Mitglied der Wach- und Schließgesellschaft, damit dir niemand deinen Reichtum stiehlt?«
»Der Schloßpastor habe großen Einfluß auf den Grafen, heißt es,« behauptete sie weiter.
»Der Domänenrat Mehltreter wird wohl auch ein Wort haben,« widersprach er mit Fleiß.
»Davon hab' ich noch nichts gehört,« beharrte sie, richtete sich ebenfalls auf und stützte den Rücken mit ihren beiden Kopfkissen. »Wenn man nur mal den Kaplan für sich hätte, dann ginge es; verlaß dich drauf.«
»Gestern bin ich dem Grafen begegnet,« erzählte er.
»Wo bist du ihm begegnet?« fragte sie angelegentlich.
»Im Sägewerk natürlich, wo er Tag für Tag aufpaßt und die Stämme zählt und die Bretter zählt und acht gibt, daß der Wind keinen Splitter fortweht. Und derweil kriegt sein Geld Füße und verschwindet zu allen Hintertüren hinaus.«
»Hast ihn doch angesprochen?«
»Nein,« sagte er.
»Das hättest aber tun müssen, Lorenz. Wie kann man so was vergleichgültigen?« tadelte sie und schlug mit den Händen auf das bauschige Oberbett. »Guten Tag, Herr Graf, hätt' ich an deiner Stell' gesagt, guten Tag, mit Verlaub und nichts für ungut, Herr Graf, aber ich hätt' ein kleines Anliegen, Herr Graf. Nehmen es Seine Durchlaucht nicht in übel, wenn ich halt so frei war und um die Verwaltersstell' eingegeben hab', und wenn ich jetzt noch so beiläufig ein gutes Wort für mich einlege, Herr Graf. So hätt' ich gesagt, wenn ich an deiner Stell' gewesen wär. Und dann hätt' ich ihm den ganzen Fall gründlich expliziert.«
»Wenn dir aber der Graf über die Eichenstämme weg davongesprungen wäre, wie er es mir getan hat, wie hättest du dann gesagt?« foppte er.
»Es gibt nichts anderes, als man wendet sich noch extra an den Kaplan,« sagte sie.
»Das darfst mich nicht lang' heißen. Das tu' ich schon. Aber das tun die andern alle auch. Soweit wirst du die Welt kennen,« sagte er und rülpste sich wieder.
»So meine ich es jetzt nicht, Lorenz,« erklärte sie zutulich und strich mit den Handflächen über die Bettzieche weg. »Man müßte sich beim Kaplan nur erst mal gut dranmachen, Lorenz, verstehst du mich, und ihn für sich gewinnen. Verstehst du mich?«
Daisenrieder aber ließ sich wieder auf sein Kissen zurückfallen, schloß die Lider und hörte der Frau Mechthilde zu, halb davon träumend, wie schön es wäre, wenn er die Stelle bekäme, und halb neugierig darauf, was seine Frau ihm nun wieder für Mittel vorschlüge. Er war übrigens zum voraus sicher, daß er keines dieser Mittel anwenden würde, sondern vielmehr ganz seinem eigenen Kopf folgen müsse, wenn er etwas erreichen wollte.
»Der Herr Kaplan sei jeden Mittag um viere in der Schloßkirche und bete sein Brevier, hab' ich sagen hören, und ich selber hab' ihn auch schon dort angetroffen,« sagte sie weiter.
»Jawohl, und was willst du damit?« fragte er aus seinem Dunkel heraus.
»Man müßte die nächsten Tage z. B. mal – eine Wallfahrt machen,« rückte sie endlich heraus.
»Jetzt glaub' ich bald, du rappelst, Mechthild'!« rief er aus.
»Man könnte zum Beispiel ganz gut die Stationen beten, und wenn uns dann noch zufällig jemand vom Schloß sehen tät, wär's auch kein Schaden nicht. Jetzt, wo das Laub von den Bäumen weg ist, sieht man deutlich vom Schloß auf den Kreuzweg hinüber,« redete sie aber unbekümmert weiter. Er lachte immer nur und stieß den Atem so heftig durch die Nase, als wollte er eine Dampfmaschine nachahmen.
»Und zum Schluß täte man die Aufopferung in der Schloßkirche abmachen. Da brauchst gar nit lachen, Lorenz. Das wär' noch gar nichts Einfältiges und auch gar nichts Unrechtes. Und wenn's was nützen tät, wär's dir so lieb wie mir. Das ist nun mal so: wenn man Wasser will, muß man zum Brunnen gehen. Auch ist das Wallfahrten noch nie eine Sünd' gewesen. Und wenn man Gott darum bitten darf, daß man in Himmel kommt, darf man ihn auch darum bitten, daß man Schloßverwalter wird,« sagte sie allen Ernstes. »Daß du aber die Stellung so gut wie jeder andere versehen kannst, wirst mir wohl noch glauben wollen,« schloß sie, an seine schwache Seite sich wendend.
»Sicher mal so gut oder besser als der alte Schloßverwalter selig,« sagte Daisenrieder nun ganz ernsthaft.
»Na also, was besinnst du dich dann noch lang?« predigte sie, indem sie ihr vom hellen Übereifer locker gewordenes Kopftuch festband.
»Das erste wär', daß ich das Einfahrtstor anders anstreichen ließe oder es selber anstriche. Es ist eine Schand', was das Tor für ein Gesicht gegen die Straße hin macht,« sagte er. »Und auch die drei alten Eschen im Hof müßten mir umgemacht werden.«
»Na also!« ermutigte sie ihn.
»Und inwendig im Schloß fehlt es auch da und dort. Eine Schand', solch' ausgeschlorkte Fliesen, wie sie der untere Flur noch hat.«
»Na, also, siehst du, du hättest doch den Kopf dazu, Lorenz.«
»Was aber eben nicht anders sein könnte, ließe ich natürlich wie es ist. Denn wenn ich mal Verwalter wär', wär' mir meine Ruh' eben wohl was wert, verstehst mich? Das kann ich dir gleich zum voraus sagen.«
»Na, also!« rief sie zum vierten Male.
Er drehte sich um und legte sich auf die Seite, sein Antlitz der Frau Mechthilde zuwendend. »Das Einfachste wär', man tät' die Sach' gleich morgen nachmittag abmachen. Zur Hildegard oben, die ja[59] doch alles gewußt haben muß, tät man ganz einfach sagen, man müsse auf eine Hochzeit oder zur Kindstauf' nach Moosheim. Was meinst?«
»Daß du ganz recht hast, mein' ich,« lobte sie ihn. »Ich sag's ja immer, es kommt bloß darauf an, daß der Kaplan mal eine gewisse Ansicht von dir kriegt, und die kann er nur kriegen, wenn er dich sieht. Ein Kaplan ist in diesem Punkt auch ein Mensch wie wir andern. Und nachher kannst du dann immer noch bei ihm vorstellig werden und beim Grafen Besuch machen und beim Domänenrat oder wo du willst. Wenn's nur mal erst richtig angefaßt ist, das andere kommt dann von selber; verlaß dich darauf. Aber richtig anfassen muß man es.« Sie wiederholten noch einigemal, was sie eben gesprochen hatten, und es blieb nun dabei, daß sie morgen nach dem Mittagessen ihre Wallfahrt ausführen wollten.
Nun war es ganz still in der Kammer, und man hörte draußen einen Hund dumpf vor sich hinbellen und dann wieder breit hinausheulen.
»Wenn das Viech mal still wär', hätt' ich nichts dagegen,« schalt er.
»Es ist dem Feilenhauer seiner. Wenn du recht nachguckst, hat der Feilenhauer auch um die Verwalterstell' angehalten. Aber kriegen tut sie halt bloß einer,« redete sie ihm zu, weil sie wußte,[60] daß er nur der Stelle wegen auf den Hund so bös war.
Jetzt klingelte das Ladenglöckchen beim Strumpfwirker drüben, und bald darauf ließ der Nachbar den Rollladen herunter.
»Schon neune,« gähnte Frau Mechthilde in einem langgezogenen hellen Schwung.
»Wär' wirklich nichts Dummes, die Schloßverwalterstelle,« murmelte er nochmals, halb in Schlaf und Traum. – – –
Des andern Morgens ging Daisenrieder zunächst wie gewöhnlich seinen Handwerkspflichten nach. Er schritt also, den Bleistift hinterm Ohr und den gelben Maßstab in der ausgeschlitzten Rocktasche, durch die Baldungsstraße und Goethestraße, rauchte seine Zigarre und überdachte, wie er dem Kleiderschrank der Frau Stiegele wieder auf die Beine helfen könnte. Jedenfalls mußte er sich den Kleiderschrank erst mal ansehen, wenn er ihn aufrichten wollte. Vorher konnte er überhaupt nichts sagen. Die Frau Stiegele hatte da merkwürdige Ansichten. So schnell ging das Ding doch nicht …
Mußte ein neuer Fuß eingesetzt werden. »Würde innerhalb der nächsten acht Tage, spätestens aber bis zum Thomastag erledigt werden,« versprach er der Frau Stiegele.
Nun wollte er heim, um den Kindersarg, der[61] bereits vollendet in der Werkstatt stand, zu Oberlehrers zu tragen, ward aber auf dem Weg vom Rathausdiener aufgehalten, der ihm bekannt gab, daß die Tür zum Sitzungssaal ripste. Nach einer halben Stunde war der Fehler behoben und die Tür konnte nun ohne Ripsen auf- und zugemacht werden. Und Daisenrieder entzündete die vierte Zigarre am Stummel der dritten und wandelte heim zum Vesperbrot.
»Wär' schon recht schön, wenn er, statt so umherzuwalzen, zu einem der schönen Schloßfenster über Wittenberg her und ins weite Tal hinunterschauen dürfte.« – – –
Sein Frühtrunk in der Schwanenwirtschaft fiel heute reichlicher als gewöhnlich aus. Dann sägte er vor dem Mittagessen noch eine Weile an einem Brett herum. »Wär' doch recht schön, wenn – –.«
Um die zweite Mittagsstunde verließen die beiden Pilgrime ihre kleine Klause.
Daisenrieder hatte seinen schwarzen Flügelrock angezogen, den er seit seiner Hochzeit bei allen wichtigen Gelegenheiten trug. So konnte er auch die Ausrede, sie gingen zu einer Kindstaufe nach Moosheim, leichter aufrechterhalten. Und die Frau Mechthilde hatte das schöne rot und blau gestreifte[62] Kopftuch auf, dessen lange Fransen so drollig auf dem dunkeln Obermäntelchen hüpften, und hatte den blauen Rock an, den sie nun sorgfältig hochhob, damit ihm kein Leides geschähe und der rote, halbflanellene Unterrock auch zu seinem Rechte käme. An der ersten Kreuzwegstation legte Daisenrieder seine Zigarre weg, auf den Astwinkel eines nahen Birnbaumes. Alsdann nahm er den schwarzen Filzhut vom Kopf und hielt ihn mit den Daumen der gefalteten Hände dicht vor den Leib. Nun sah man auch seine helle Glatze, über die ein paar einsame Fäden krochen, ins Ferne hineinstrahlen. Ein luftiges Schweißwölkchen aber rauchte und wirbelte gen Himmel hinauf. Die runden Wangen waren hochrot, und die drusige Nase ragte glanzblau aus der Glut heraus. Vom fetten Nacken quoll ein dicker Wulst gegen den schwarzen Flügelrock herunter. Die kühle Dezemberluft aber spielte mit den beiden Rockschößen und machte es so der Frau Sonne möglich, sich hin und wieder in dem breiten Hosenspiegel zu beschauen.
Wenn Daisenrieder oder die Frau Mechthilde jetzt um sich geblickt hätten, hätten sie noch sehen müssen, wie der Schloßkaplan zum Tor hinauswanderte und auf der andern Seite des Schloßberges den Staffelweg hinunterstieg. Denn der Schreinermeister Daisenrieder hatte in der Tat einige[63] Aussicht auf den Verwalterposten. Seine Bewerbung hatte einen ganz guten Eindruck gemacht. Und nun sollte der Herr Kaplan den Mann aufsuchen und mit ihm reden und dann seinen Bericht erstatten. –
Die Frau Mechthilde aber begann jetzt das Stationengebet. Und dann beteten beide zusammen und fügten das Vaterunser an.
Sie beteten recht und im Ernste, wie es sich geziemte, und machten ihre Kniebeuge, wie es sich gehörte, und betrachteten die gemalte Leidensgeschichte des Herrn und machten ihre Anmutungen dazu. Und freilich, zwischen-hinein dachten sie auch an die Verwalterstelle. Das war nur menschlich und natürlich. Und wenn sie die Stelle auf dem Kreuzweg erbeten konnten, so war das nur löblich. – – In der Nähe des Schlosses, wohin die Stationen führten, wurden ihre Stimmen noch eindringlicher. Und das Rauchwölkchen über dem kahlen Haupte des Schreinermeisters ward noch sehnlicher.
So aber etwa der Graf vom Schloß aus zusah oder zuhörte, so war da gar nichts dabei. Das konnte einem im Gegenteil nur angenehm sein. Es hatte ja ein jeder Mensch seinen freien Willen, zuzuschauen oder nicht zuzuschauen, und es hatte ein jeder Christenmensch das Recht, sein Licht auf den Scheffel zu stellen und leuchten zu lassen. Dies lehrte schon die Heilige Schrift. – –
Der Graf hatte indessen weder die Augen noch die Ohren an einem der hohen Fenster, sondern weilte um diese Stunde oben in der Seitengalerie der Kirche, die durch einen Gang mit dem Schlosse verbunden war. Hier pflegte er täglich ziemlich lange zu verharren und dann auch sogar ein Auge auf den Schloßkaplan, der im Chorgestühl unten seinen Platz hatte, durchs Gitter zu werfen.
Auch diese Tatsache war in Wittenberg nicht unbekannt. Im Herrenstübchen zum Hahnenkeller vollends wußte man ganz genau, daß der Graf seine Frömmigkeit manchmal bis zum Äußersten trieb und selbst seinem Schloßkaplan hin und wieder Schwierigkeiten bereitete.
»Er sollte sich eine Frau nehmen und auf die Jagd und in Gesellschaft gehen und nicht bloß Bretter zählen,« sagte auch der Herr Kaplan, wenn er im Hahnenkeller im Kreise seiner Freunde saß.
Merkwürdigerweise hatte die Frau Mechthilde, die doch sonst alles wußte, nie davon erfahren.
Als unsere Pilgrime laut betend die Kirche betraten, war noch kein Kaplan zu erblicken.
»Er wird schon kommen,« sagte Frau Mechthilde zwischen ihr Vaterunser hinein und schritt auf die vorderste Stuhlreihe der Frauenseite zu, während ihr Mann Daisenrieder rechts auf der Männerseite Platz nahm.
Dem Grafen in der Galerie oben gefiel der schlichte Sinn dieser Leute. Neugierig guckte er durch eine Lücke des Gitters. Er erkannte die Leute zwar nicht gleich genau und bei Namen, aber er erinnerte sich doch, daß er schon in seiner Sägemühle mit dem Manne zu schaffen gehabt hatte. Und nun kam ihm auch plötzlich der Name des Mannes wieder. Daisenrieder hieß er, ganz richtig, derselbige, der sich auch um die Verwalterstelle gemeldet hatte.
Mit hallender Stimme sprach Frau Mechthilde das Gebet zur vierzehnten Station noch einmal vor. Daisenrieder aber hatte unterdessen den Kopf nach links und rechts gedreht. Denn er war allmählich müde geworden. Und als er sich überzeugt hatte, daß keine Seele zugegen war, sagte er mißmutig: »Das haben wir doch schon gebetet. Ich werd' doch nicht zweimal das Gleiche beten. Überhaupt fang' ich allmählich an, genug zu kriegen.«
»Er kann alle Augenblicke kommen,« warnte Frau Mechthilde und erstach ihn fast mit ihren Augen. Und dann wiederholte sie das Gebet.
»Jedenfalls möcht' ich mich jetzt ein bisserl verschnaufen,« brummte er trotzig. Gleichzeitig ließ er sich auf das Sitzbrett fallen, daß es krachte, holte sein rotes Sacktuch aus der hinteren Flügeltasche[66] und trocknete sich den Schweiß vom Haupt und vom Hals und vom Nacken und blies die Hitze von sich weg.
»Geh, mach keine Dummheiten, Lorenz, nun kann er jeden Augenblick da sein,« warnte sie inständig.
»Dann ist's immer noch Zeit. Ich sag' dir, ich bin hundsmüd',« warf er ihr trotzig zu.
»Du verdummst noch die ganze Wallfahrt.«
»Aber der einzige Dumme bin ich, gottlob, ja nicht. Verstehst mich?« lachte er beißend.
»Sei wenigstens jetzt ruhig! Wenn du schon nimmer mittun willst, so verhalt' dich wenigstens ruhig,« keuchte sie, ihren Zorn hinunterwürgend.
Und jetzt war es so still in dem Gotteshause, daß man einander atmen hörte. Die Stille sang einem förmlich in den Ohren.
»Ich laß mich aufhängen, er kommt nicht,« sagte Daisenrieder nach einer Weile wieder.
»Lorenz! Sei doch wenigstens ruhig.«
Die gemalten Fenster zu beiden Seiten des Hochaltars waren wirklich wunderschön. Die Muttergottes mit dem Kinde und die Engel sahen einen so traulich an, und ihre farbigen Kleider glänzten prächtig im Licht der Sonne. Man konnte schon eine Zeit lang seine Augen unterhalten und gute Gedanken im Kopfe haben, aber alles hatte seine[68] Zeit und sein Ende. Und beten konnte man ja nach all dem Ärger nicht!

»Ich sag's nochmal, ich laß mich aufhängen, er kommt nicht.«
»Jetzt hab doch bloß ein bisserl Vernunft und Geduld, Lorenz!« flehte sie.
Er holte noch einmal das Sacktuch aus der Flügeltasche hervor und trocknete sich noch einmal umständlich ab. Dann entdeckte er einen breiten Lichtstreifen, der durch eine Scheibe auf den Kirchengang hereinfiel. Die unzähligen Sonnenstäubchen wogten darin auf und nieder und hin und her und wirbelten im Kreise herum, wenn er nur das Haupt bewegte oder den Unterarm aufhob und wieder sinken ließ. Das Spiel war wie hergerichtet zum Betrachten und Beobachten. Doch eine Ewigkeit lang konnte man auch das nicht betreiben.
»Weißt was? Jetzt mach' ich mein Kreuz und mach', daß ich hinkomm', von wo ich herkommen bin,« fuhr er plötzlich auf.
»Vielleicht ist er heut verhindert und kommt ein bisserl später,« sagte sie noch einmal in gutem.
»Geh, was kümmert mich überhaupt dein Kaplan,« ärgerte er sich immer mehr.
»Schrei wenigstens nicht so!« flehte sie.
»Meinetwegen kann er es auch hören, wenn er Lust hat. Das schert mich gar nicht. Verstehst mich?[69] Eine recht einfältige Sach', die du da ins Werk gesetzt hast, daß du's nur weißt!« warf er ihr hin, ohne seine Stimme im mindesten zu sparen.
»Aber du bist doch mitgangen,« entgegnete sie jetzt stechend, und die bunten Kopftuchfransen wehten aufgeregt um das dunkle Obermäntelchen.
»Man sollt' sich nie von einem Weibsbild was raten lassen! Ich hab' es mir aber auch gleich gedacht,« schimpfte er aus dem Vollen.
»Aber mit bist doch!« versetzte sie noch spitziger. »Und wenn du Schloßverwalter werden tätst, wär's dir auch recht, oder nicht? Das wirst wohl nicht leugnen wollen.«
»Aber deine einfältige Wallfahrt brauchte man deswegen noch lang' nicht! So eine Dummheit!« schrie er wütend ihr entgegen.
»Daß du dein Lebtag nie Schloßverwalter wirst, das kann ich dir nun nächstens schwören! Dann läßt du halt einen andern auf den Platz sich hinsetzen und trägst deine Kindssärge spazieren bis an dein seliges Ende! Eine wirklich nette Aussicht!« rief sie voll Galle.
»Nun hörst mir aber auf! Verstanden?« schrie er und ging auf sie zu.
»Fällt mir gar nicht ein,« erklärte sie jedoch gleichmütig und schaute ihm fest ins Gesicht.
»Gut, dann adjö, ich geh' jetzt heim. Tu, was[70] du willst,« sagte er in verändertem Tone. »Meinetwegen kannst du ja auch dableiben und auf deinen Kaplan warten, so lange es dir nur beliebt, und ihn heiraten, wenn es dir gefällig ist, und den Grafen dazu, wenn du Lust hast! Ich hab' gar nichts dagegen! Ich geh' jetzt meiner Wege, adjö.«
»Du bist doch ein rechter Dummkopf, Lorenz!« platzte sie heraus. »Das sag' ich dir aber jetzt, so oft du es nur haben willst!«
»Und wenn wir jetzt nicht in der Kirch' wären, tät ich dir jetzt eine herunterhauen! Das sag' ich dir ebenfalls! Und jetzt machst gleich, daß du mit heimkommst, oder ich sag' dir noch was andres! Verstehst mich? Denn verlaß dich drauf, daß ich dir von jetzt ab um den Schloßverwalter keinen Schritt mehr mache, und weder zum Kaplan noch zu Pilatus, noch zum Grafen, noch sonst wohin gehe, sondern Kindssärge spazieren trage, so lang es mir Spaß macht. Verstehst mich? Und schließlich ist das so schön und so nützlich wie das einfältige Bretterzählen, das der Graf besorgt. Und überhaupt, unter so einem Esel möcht' ich nicht 'mal Verwalter sein. Verstehst mich? Nun wirst wohl keinen Zweifel mehr über meine Gesinnung haben? Und jetzt machst sofort, daß du heimkommst!« schrie er, alles Bessern vergessend.
»Wenn ich möcht,« entgegnete sie leise und grimmig.[71] Und dann kniete sie ihm zum Trotz wieder nieder und begann laut und klingend vor sich hin zu beten.
Daisenrieder aber stand mit geballten Fäusten hinter ihr und fletschte die Zähne. Und wer weiß, wohin ihn der nächste Augenblick noch gebracht hätte, wenn nicht vom Galeriegitter oben plötzlich eine Stimme gerufen hätte: »Es genügt jetzt schon, ihr frommen Leute, es genügt jetzt schon.«
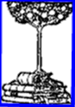

Rudolf Greinz ist Tiroler und ist ein Erzähler von der guten alten Art. Als Tiroler kennt er seine Landsleute, kennt diese Holzbauern, Knechte und Mägde, die uns seine Geschichten schildern: die Biederen und die Verschlagenen, die Dickköpfigen und die Leichtherzigen, die Gutmütigen und die Geizhälse, wie sie nur noch der Herr Pfarrer vom Beichtstuhl her kennt. Die Romane und Novellen nicht minder als die »Bauernbibel«, das »Krippenspiel« nicht minder als die dem Leben nachgedichteten drolligen »Marterln« beweisen diese innige Vertrautheit mit der Vorstellungswelt des Tiroler Bauern und eine wahrhaft dichterische Kraft der Einfühlung. Eine besondere Neigung hat Greinz, auch darin seinem steirischen Nachbar Rosegger verwandt, für die Schnurre, die seinem Vergnügen an bäurischen Till-Eulenspiegeleien und seinem Humor volkstümlich entgegenkommt: sein herzhaftes Lachen lacht aller Torheiten und liebt dabei doch die törichten Menschlein, die sie begehen. Greinz lebt in München; geboren ist er in Pradl, am 16. August 1866.
L. Adelt.

Das Hennendiandl.
Die dummen Geschichten, die einem selber passiert sind, erzählt man regelmäßig am unliebsten. Zur heilsamen Buße für unterschiedliche Sünden muß ich mein Abenteuer mit dem Hennendiandl aber doch einmal auskramen.
Es ist schon ziemlich lange her. Ich war damals in der höchsten Blütezeit der holdesten Jugendeselei. Es war in den Ferien nach meiner Gymnasialmatura. Ich genoß meine frisch erworbene Freiheit mit vollen Zügen in Gestalt einer Sommerfrische im Brandenberger Tal.
Von Rattenberg im Unterinntal aus wanderte ich an einem Julitage mit dem Schnerfer11 am Rücken über das uralte romantische Frauenklösterlein Mariatal in die Bergeinsamkeit von Brandenberg. Durch rauschenden Buchenwald entlang der Brandenberger Ache, deren spiegelklares Wasser einen ganz eigenartigen Perlmutterglanz hat. Völlig wie zauberische Farben von Märchenbronnen. Eine[76] weite Strecke über einen schier ebenen Saumpfad und schließlich steil empor nach der im Hintergrund des Tals gelegenen Gemeinde Aschau.
Ein richtiger Schinderweg, der einem bei Sonnenglut den letzten Schweißtropfen aus den Poren treibt. Aber droben auf den grünen Bergmatten, über die sich weit verstreut die Bauernhöfe von Aschau breiten, ist's dann um so herrlicher. Man sieht nicht allzu fern in der Runde. Die Welt ist eng begrenzt da droben. Um so leichter vergißt man auf die Welt draußen.
Aschau hat ein einziges kleines Wirtshäusl. Ein richtiges Bauernwirtshäusl, in dem es wohl einen guten Tropfen Wein, aber in der Kost verdammt wenig Abwechslung gibt. Speckknödel, Schmarrn, Geselchtes mit Kraut, Topfenbaunzen12 oder Erdäpfelnudel, das macht so ziemlich die ganze Speiskarte aus. Höchstens einmal ein frisches Schweinernes, wenn gerade ein Bauer schlachtet.
An Werktagen war es recht einsam in dem Wirtshäusl. Kaum daß sich hie und da ein Gast dahin verirrte. An Sonn- und Feiertagen ging es aber sehr lebhaft zu. Da kamen die Bauern und Knechte und huldigten dem Vergnügen des Kegelscheibens. Es war eine prächtige Kegelbahn beim[77] Wirt, auf der oft hitzige Schlachten ausgefochten wurden.
Schon am ersten Sonntag meiner Sommerfrische in Aschau hatte ich den Kranzelscheiber Lex kennen gelernt, der alsbald mein besonderer Freund und Vertrauter wurde. Mit seinem gewöhnlichen Namen hieß er Alexius Hupfauf und war Knecht beim Kirchebner, einem größern Bauern in Aschau. Der Lex war der beste Kegler in der ganzen Gegend. Daher auch sein Name Kranzelscheiber Lex.
Er weihte mich in die höheren Geheimnisse des Kegelscheibens ein. Wie man eine sogenannte »Prälatenwurst« scheibt, d. h. auf einen einzigen Wurf die drei mittleren Kegel mitsamt dem König zu Fall bringt. Dann die schwierigere Technik der Kranzeln. Da gilt es, auf drei Würfe sämtliche Kegel mit Ausnahme des Königs in der Mitte zu fällen. Und endlich das Ideal jedes Keglers: das Naturkranzel. Das ist das oben erwähnte Kranzel auf einen einzigen Wurf. Die Naturkranzeln sind übrigens so selten, daß sie mit Jahr und Datum an den Balken der Kegelbahn angekreidet werden.
In der freien Zeit, die mir das Kegelscheiben und das Herumstrapanzen13 in der Gegend ließ,[78] hatte ich mich schauderhaft verliebt. Der Gegenstand meiner Verehrung war ein junges, etwa neunzehnjähriges Diandl mit dunkelbraunen Zöpfen, braunen lustigen Augen und einem herzigen G'sichtel. Das Vronele beim Gschwentnerbauern.
Der Gschwentner war der reichste Bauer in Aschau. Sein Gehöft konnte wahrhaft stattlich genannt werden. Ein breit und massig hingebautes Bauernhaus mit großem Stall, Heustadel und Tennen und mit einem ausgedehnten grünen Anger.
Die Gschwentnerbäuerin hatte eine geradezu leidenschaftliche Vorliebe für Geflügelzucht. Das größte Kontingent stellten natürlich die Hennen. Es waren aber auch ziemlich viele Enten und Gänse auf dem Hofe vorhanden. Sogar ein welscher Truthahn stolzierte in dem Anger umher.
Für die Hennen hatte der Bauer einen eigenen Stall errichtet. Ein kleiner Teil des Tennen war zum Hennenstall umgebaut worden, zu dem vom Erdboden aus ein schmales Stiegerl hinaufführte.
Für die Hennen und das übrige Geflügel hatte sich die Bäuerin eine eigene Dirn angestellt, die in Aschau allgemein nur das Hennendiandl hieß. Und dieses Hennendiandl war eben das Vronele, an die ich mein Herz verloren hatte.
Natürlich hatte meine Angebetete davon keine Ahnung. Über ein paar schüchterne Versuche, mit[79] ihr ein Gespräch anzuknüpfen, war ich nicht hinausgekommen. Und diese Gespräche drehten sich immer nur um die Hennen. Bei diesem Thema blieb ich unrettbar kleben und suchte vergebens den nötigen Übergang zu einer Eröffnung meiner Gefühle.
In dieser verzwickten Lage kam mir der Kranzelscheiber Lex zu Hilfe, den ich in mein Geheimnis einweihte. Er hatte mir mit entschieden großer Aufmerksamkeit schweigend zugehört, lachte unter meiner Erzählung mehrmals verschmitzt und tat schließlich die schmeichelhafte Äußerung: »Weißt was, du bist a dalketer14 Teufl. Ös Stadtlinger habt's halt alle an Leibschaden im Hirn! Dö G'schicht' mit 'm Hennendiandl hast ja ganz verdraht ang'fangt: da muaßt zum Vronele fensterln geh'n, wenn d' wissen willst, wia d' dran bist!«
Als ich ihm erklärte, daß ich so was doch nicht recht wagen würde, fuhr mich der Lex an: »Laß dich nit auslachen, du Trauminit! Wenn du dein Herz in der Hosen hast statt am richtigen Fleck, nacher wirst nia was ausrichten bei an saubern Diandl! Übrigens, weil's du bist, will i 's erste Mal mit dir geh'n und dir 's Loaterl halten.«
Ich war überglücklich, daß sich der Lex so echt freundschaftlich meiner annahm, und befand mich drei Tage lang in großer Aufregung und in spannender[80] Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Denn so lang dauerte es noch, bis der Fensterlgang angetreten wurde.
Es müsse eine stockfinstre Nacht sein, hatte der Lex gesagt. Da jetzt Neumond eintrete, hätte ich gerade die günstigste Zeit erwischt. Inzwischen hatte mir der Lex auch gesteckt, daß mich, soweit er sich auskenne, das Vronele gar nicht so ungern sehe.
Stockfinstre Nacht war's, als ich mit dem Lex den Weg zum Gschwentnerhof hinauftappte. Schwere Wolken zogen am Himmel. Eine schwüle Sommernacht. Ich stolperte neben dem Lex dahin, der eine kleine Leiter trug.
Endlich kamen wir an den Angerzaun des Gschwentner. Ein Gatterl knarrte. Es ging über weichen Rasen dahin. Das Gehöft war nur in ganz verschwommenen Umrissen gegen den dunklen Nachthimmel zu erkennen. Kein Lüfterl regte sich. Ein paarmal wäre ich bei einem Haar mit dem Schädel gegen einen der Bäume im Anger gerannt.
Jetzt schienen wir zur Stelle zu sein. Wenigstens machte der Lex Halt und lehnte die Leiter gegen die Mauer. Mein Herz klopfte hörbar.
»Da is 's Kammerfensterl vom Vronele!« flüsterte der Lex. »Jatz pass' auf, damit 's nächste Mal 's Fensterln selber kannst!«
Der Lex tat mit der Zunge ein paar Schnaggler, daß es klang wie gedämpftes Peitschenknallen. Dann begann er halblaut mit unterdrückter Stimme zu singen:
Und so ging es noch ein paar Strophen weiter. Nichts rührte sich.
»I will amal z'erst aufisteig'n und a bissel anklopfen!« sagte der Kranzelscheiber Lex leise und stieg im nächsten Augenblick flink wie ein ›Oacherl‹15 die Leitersprossen empor. Ich hörte, wie er mehrmals klopfte.
Wiederum lautlose Stille. Dann hörte ich den Lex sagen: »Mir scheint, 's Vronele rührt sich schon!«
Bald darauf vernahm ich, wie sich etwas in den Angeln drehte. Gleichzeitig kletterte der Lex die Leiter wieder herunter.
»Sie hat 's Fensterl aufg'macht!« flüsterte er. »Schleun'16 dich, steig' ein!«
Er schob mich gewaltsam zur Leiter und schob noch hinter mir nach, daß ich, ob ich nun wollte oder nicht, nach oben klettern mußte.
»Steig' ein!« hörte ich den Lex, der hinter mir auf der Leiter stand.
Ich tastete um mich und griff eine Art Fensterbalken. Eine warme dunstige Luft schlug mir entgegen.
»Steig' ein!« hörte ich noch den Lex sagen. Dann schob er mich durch die Öffnung im Gebälk durch. Ich purzelte nach vorn ins Dunkle. Noch ein kräftiger Schub des Lex, und ich war drinnen. Hinter mir hörte ich es zuschlagen und einen Riegel vorschieben.
Das war das Werk weniger Sekunden. Ich tastete um mich und griff mit den Händen in lauter Stroh. Dann richtete ich mich auf und stieß mir den Kopf derart an den Überboden des Raumes, in den ich geraten war, daß mir die hellen Funken vor den Augen tanzten und ich unwillkürlich in die Knie sank.
Gleich darauf ging rings um mich herum ein Heidenspektakel los. Ein Springen und Flattern und aufgeregtes Gackern, daß ich vorläufig ganz[83] betäubt war. Ich kam jedoch rasch genug zu der Erkenntnis, daß ich mich nirgend anderswo befand, als im Hennenstall. Das in seiner Nachtruhe gestörte und durch meinen plötzlichen Einbruch ganz entsetzte Hennenvolk tobte wie wahnsinnig um mich herum.
Ich schlug mit beiden Armen aus und trommelte mit den Fäusten gegen die feste Balkenwand. »Lex!« rief ich, »Lex! I bin im Hennenstall. Wir haben 's Fensterl verfehlt! Mach' auf, Lex!«
Keine Antwort erfolgte. Ich glaubte jedoch ein unterdrücktes Lachen von draußen zu hören.
»Aufmachen, Lex! Hast g'hört!« trommelte ich weiter. Keine Erhörung. So polterte ich wohl noch eine Viertelstunde.
Während dieser Zeit kam es mir zur Erkenntnis, daß der verflixte Lex mir einen Possen gespielt hatte. Je mehr ich wütete, desto rasender wurden die Hennen.
Daß man im Haus von dem Spektakel im Hennenstall nichts hörte, dafür fand ich erst später die Erklärung. Der Tennen lag weit nach rückwärts und war von dem Haus durch den Stall und durch den mächtigen Heustadel getrennt. Zudem gingen die Fenster der Schlafkammern alle nach vorn heraus. Bei dem gesunden Schlaf, den ein Bauer hat, hätte ich also wohl noch die halbe Nacht toben können.
Ich beruhigte mich aber schließlich und kauerte mich in stumpfer Verzweiflung in eine Ecke des Hennenstalles, durch dessen Türl mich der Lex statt durch Vroneles Fensterl hatte schlüpfen lassen. Ich kam mir unsäglich dumm vor. Ich glaube sogar, ich habe vor Zorn geweint.
Mit mir beruhigten sich auch die Hennen. Sie schienen sich mit meiner Anwesenheit abgefunden zu haben. Nur hie und da flatterte eine herum. Dann aber hockten sie offenbar wieder auf.
Es kommt mir vor, als ob ich einige Zeit geschlafen hätte. Neuerliches Geflatter brachte mich wieder zu mir selber.
Durch die Ritzen im Holzbau des Hennenstalles brachen die Strahlen der Morgensonne. Ich hörte, wie sich Schritte näherten. Ein Riegel wurde zurückgeschoben. Das Türl tat sich auf. Der helle Morgen schien herein.
Draußen stand das Vronele und lockte die Hennen … »Bull … Bull … Bull … Bulliii …« das Geflügel enteilte dem Stall.
Zuletzt guckte das lachende Gesicht des Hennendiandls in den Stall herein. »Oha, da hockt noch a Gockl drin!« rief sie.
Ich sprang in meiner Ecke empor, stieß mir den Schädel noch einmal damisch an, kroch durch das Türl an dem Vronele vorüber ins Freie, setzte wie gehetzt[85] mit ein paar Sprüngen über das Hennenstiegerl hinunter und von da fort über den Anger, hinaus beim Gatterl und weit weg vom Gschwentnerhof.
Das Hennendiandl aber hörte ich hinter mir drein lachen, daß es völlig erstickte.
So geschämt, wie damals vor dem Hennendiandl, habe ich mich in meinem ganzen Leben nie. Noch am gleichen Tage packte ich meinen »Schnerfer« und wanderte talauswärts, um das Zelt meiner Sommerfrische in einer andern Gegend aufzuschlagen. Den Kranzelscheiber Lex aber könnte ich heute noch bei lebendigem Leib braten.
Gesehen habe ich den Lex nicht mehr. Von der Wirtin in Aschau erfuhr ich jedoch vor meinem Abschied durch vorsichtiges Herumfragen, daß der Lex schon seit mehr als einem Jahr der Schatz des Vronele war. Aller Voraussicht nach ist er in jener Nacht, während ich im Hennenstall dunstete, selber beim Hennendiandl fensterln gegangen und hat sich recht ausgiebig über mich lustig gemacht.
Vielleicht hat der Kranzelscheiber Lex im Laufe der Begebenheiten das Hennendiandl geheiratet. Vielleicht auch nicht. In jedem Fall soll ihn der Teufel holen!
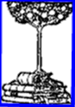

Sophus Bonde (Deckname) ist von der Waterkant: er versteht es, sein Garn zu spinnen, wie nur je ein Seebär aus der Zeit, da es noch keine Dampfer gab. Bei Windstille, wenn der Schuner tagelang mit schlappen Segeln liegt, auf Wache in sternenklaren Nächten, an freiem Sonntagnachmittagen, wenn Gelächter und Gesang, Musik und Tanz die strenge Disziplin des Dienstes ablösen, da kommt auch heute noch an Bord die eingeborene Seemannslust am Fabulieren zu ihrem Recht. Die Phantasie entfaltet sich an der unendlichen Weite des Meeres, der Klabautermann und tausend alte Sagen steigen aus ihm auf, eigene Erlebnisse zu Wasser und zu Lande verspinnen sich zu einem mehr oder weniger kunstvollen Netze lustiger und gruseliger, abenteuerlicher und märchenhafter Begebenheiten. Solch ein Erzähler von der Art, die heute auszusterben droht, ist Sophus Bonde. Derber Humor und unverwüstliche Lebenslust machen seine Geschichten zu einem Jungborn der Gesundheit, des Behagens und der Freude an den bunten Möglichkeiten des Daseins.
L. Adelt.

Jochen Appelbaums Galion.
Kap Lizard hatten wir längst hinter uns, und wir liefen vor einem steifen Ostsüdost durch den Atlantik. Eines Tages, es war Sonntagnachmittag, hatten wir es uns hinter der Back17 bequem gemacht und lagen und saßen in zwanglosen Gruppen herum. Einige hatten ihren Nähbeutel neben sich und besserten ihre Sachen aus. Jochen Appelbaum, der Segelmacher, war dabei, mit kunstgeübter Hand einen Bettvorleger für seine Frau herzustellen. Die Vorlage dazu, eine Fregatte unter vollen Segeln, hatte ich, der ich zeichnerisch veranlagt war, ausgeführt und war dadurch noch eine Stufe höher in seiner Gunst gestiegen. Nun zog er bunte Wolle, Faden neben Faden, die Farben zu der Zeichnung passend, durch das Stück Segeltuch, welches die Grundlage darstellte, und worauf die Zeichnung ausgeführt war. Über ein Jahr brauchte er zu dieser Arbeit. Als sie fertig war, war es wirklich ein[90] Prachtstück seemännischer Kunstfertigkeit und Geduld und fand unter den Kameraden die höchste Bewunderung.
Es wurde hin und her geredet, über dies und jenes, und als eine Stockung eintrat und das Gespräch nicht weiter wollte, meinte der Karpenter18: »Wie wär dat, wenn ein von uns ein Ende Schimannsgarn spinnt, de Tid löbt denn so moy und een wird nicht dümmer davon. Laat man ein los, Sailmocher, du heß veel von de Sort in't Hellegatt19. Man los!«
Jochen Appelbaum schmunzelte und meinte: »Tja, wenn't jug Spaas mokt, will ik jug ein lütt Geschicht ut mine Orlogstid20 vertellen.«
»Ja, man tau! Man tau!« riefen die Gasten im Chor und rückten dichter zusammen, damit ihnen ja nichts von der Erzählung verloren ginge.
»In den Jahren achteinhundertvierundföftig und fifundföftig diente ich in der dän'schen Marine als Matrose, und zwar an Bord von de Kreuzerfregatt ›Jülland‹.«
»Wie kömmt dat, dat du in de dän'sche Marin deint hast, wo wir alle sonst in die dütsche deinen möten?« fragte der Matrose Franz Klattstert, ein Danziger.

»Dat will ich di seggen,« erwiderte der Segelmacher. »Erstens hatte Deutschland damals noch keine Marine, zweitens war Schleswig noch dänisch und die jungen Leute mußten darum noch ihre Militärpflicht in Dänemark absolvieren, und drüttens bis du een Schaapskopp, wenn du dat nicht weißt …
Ich war also als Orlogsgast eingezogen und diente auf der Kreuzerfregatte ›Jülland‹. Nun müßt ihr euch aber nicht so 'n Fregatt mit den heutigen Schlamasselkastens, die sie Kriegsschiffe nennen, vergleichen. Nein, das war ein richtiges Schiff, wie unser hier, mit richtigen Masten, mit Rahen, Segel und Takel; von richtigen Schiffsbauers gebaut und getakelt, und nicht so 'n Mißgeburt, wie die Eisenfritzen jetzt bauen. Damals mußte das Schiff mit Seeleute bemannt sein, wie unser Schipp hier, und nicht, wie die heutigen Kriegskastens, mit schmeerigen Heizers und sottigen Trimmers; und de Offizeers wären Seeleute, die von der Pike auf gedient hatten, wie unsereins, und ebensogut ein Ende splissen konnten wie ihr Besteck machen, und anderes zu denken hatten als an't Zähne- und Nägelputzen. Seeleute waren es, die mit 'n Schipp sailen konnten wie unser Keppen Claasen. Das waren Seeleute dörch und dörch und keine Herrens von die Marineakademie mit Lacksteweln und Jungfernmaneeren. Frag[93] mal einen von dissen Herrens Offizeers auf den eisernen Kriegskastens, ob sie es wagen, mit einer Kreuzerfregatte unter vollen Segeln und mit guter Brise auf ihren Ankerplatz im Hafen raufzufahren und dort mit dem Schiff um die Boje wenden und stillhalten wie ein Streichholtschachtel im Nachttopp! Tja! Das waren Seeleute, düsse Offizeers von damals! – Seeleute!
Nu also, mit so 'n Schipp war ich los, und wir waren an zweihundert Mann an Bord, lauter junge Seebären, die sich vor kein Düwel und kein Wetter fürchteten. Wir waren auf eine Tour ins Mittelmeer, als wir plötzlich Order kriegten, nach den dänischen Besitzungen in Westindien zu gehen. Die Niggers auf der Insel Sankt Thomas waren aufrührerisch geworden und murksten ihre weißen Herren ab. Wir sollten nun hin und die schwarzen Banditen beruhigen.
Das war wenigstens mal was anderes. Ein willkommenes Abenteuer, eine Unterbrechung in dat ewige Einerlei. Na, nun steuerten wir so schnell wie die Schute laufen wollte quer dörch den Atlantik nach den Kleinen Antillen, wo die Insel Sankt Thomas liegt. In ohngefähr fünf Wochen, nachdem wir die Order gekriegt hatten, warfen wir Anker auf der Reede von Charlotte Amalie. Tja, so heißt die Hauptstadt von der Insel. Als die[94] nötigen Formalitäten nun erledigt waren, wurden hundertundfünfzig Mann an Land gesetzt, die im Verein mit der Besatzung der Insel die Niggers, die im Inneren die Plantagen verwüsteten, die Häuser ansengelten und ihre Herren abmurksten, bändigen sollten.
Ich war zu meinem Unglück auch mit bei die Landpartie.
Der erste Tag verging mit An'tlandsetten, Lagerinrichten und Teltupschlagen21.
Am zweiten Tag ging de Jagd los. In kleinen Abteilungen ging es in die Plantagen und Wälder, wo die schwarzen Deuwels sich versteckt halten sollten.
O, Gottegott, wie hatten die schwarzen Beesters gehaust: überall verwüstete Zuckerplantagen und niedergebrannte Häuser, aber nirgends eine Spur von die Schwarzen.
Wir waren strenge gewarnt worden, jo und jo nicht im Vordringen die Fühlung miteinander zu verlieren. Die Schwarzen liebten es, vereinzelnd gehende Mannschaften zu überfallen und niederzumachen.
Nun weiß ich nicht mehr, wie es eigentlich zuging und wie es kam, aber mit einmal hatte ich und noch zwei Kameraden die bewußte Fühlung verloren.
Wir befanden uns gerade in einem Palmenwald. Es war eine Hitze darin wie in ein Backofen beim Feinbrotbacken, und uns lief der Schmalz in dicken Tränen man immer so den Puckel herunter. ›Gottsverdammi,‹ sagt dann mit einmal der eine Kamerad, Chrischan Kluth hieß er mit Namen, ›wißt ihr was,‹ sagt er, ›ich will euch man was sagen und ein Vorschlag machen: Ich hab' es nu satt, in diese gräuliche Bruthitze immer so bergab und bergauf zu laufen und nichts zu fressen als trocknes Brot und nichts zu trinken als lummeriges Wasser aus der Feldflasche. Wenn man wenigstens die Niggers zu sehen bekäme, damit man 'n bischen losballern konnt, oder 'n paar lüttje Niggerdeerns, woran man sacht seine Freude hatte, denn ließe ich es mir wohl gefallen; aber so? Nei. Ich hab' keine Lust mehr. Ich mache euch einen Vorschlag: Wir drei machen unter diesen schönen Bäumen eine halbe Stunde Pause, machen uns lang und nehmen ein Auge voll Schlaf.‹
›Du haßt 'n anschläg'schen Kopp, wenn du einen mit 'n Knüppel drankriegst,‹ sagte darauf der andere Kamerad, Anders Lütgen, ›aber wenn wir nu bei das Langmachen überrascht werden, was dann? Wir befinden uns sozusagen auf dem Kriegspfad, und wenn wir hier beim Schlafen überrascht werden sollten, denn so glaub'[96] ich allemal, daß uns das ganz eklich bekommen würde.‹
›Ich will euch mal was sagen,‹ sagte ich dann, ›der Vorschlag ist beachtenswert und durchaus nicht zu verachten. Ich für meinen Teil hab' es auch schon längst dick und satt, denn mir ist am heutigen Tage in der entfamigten Hitze mindestens drei Pfund Schmalz aus dem Puckel gelaufen. – Nu will ich euch mal was sagen, zwei Mann machen eine halbe Stunde lang und einer hält unterdessen die Wache. Kömmt denn was, purrt er die beiden raus. Wir sagen dann, wir hätten verdächtige Geräusche gehört und hätten uns aufs Lauern gelegt.‹
›Und wenn die Niggers nu kommen,‹ meinte Chrischan Kluth, ›was dann?‹
›Na, dann muß die Wache natürlich auch purren und gleich mit die Ballerbüx da mank ballern,‹ sagte ich dann.
Na, wir wurden schließlich über die Sache einig und suchten mank die Bäume und Büsche nach einem schönen molligen Lagerplatz.
Wir finden auch bald einen, an 'ne kleine Lichtung, unter einem großen Baum.
Durch Los wurde Chrischan Kluth zur Wache bestimmt.
Wir verabredeten uns, daß er nach einer halben[97] Stunde mich wecken sollte, worauf er eine halbe Stunde schlafen konnte.
Nun legten wir uns in den Schatten von dem großen Baum, ins weiche, schöne Gras und schliefen in der bannigen Hitze auch baldigst ein.
Wie lange wir geschlafen haben, weiß ich nicht, Chrischan wußte es nachher auch nicht, denn als er sah, wie friedlich wir schliefen, dachte er: ›Ach wat, 'n lütt bitten Nicken kannst du auch, hier ist's ja still und friedlich wie daheim in Mudders Schlafstube; hier findet uns kein Minsch. Schlafen tue ich ja auch nicht, blots 'n lütt bitten Nicken.‹
Und Chrischan nickt und schläft ein.
Als wir endlich aufwachten, war es schon spät am Nachmittag, und um uns rum krimmelte und wimmelte es von Niggers. Einige waren schon dabei, uns festzubinden.
O Gottegott, dachte ich, nu is deine letzte Stunde gekommen. Und ich dachte, ob der liebe Gott mir auch alle meine Sünden vergeben würde …«
»Du dachst also, dat du mit alle dine Sünden in den Himmel kämest?« bemerkte hier der Karpenter.
»Tja, dacht hew ik dat, denn ich bin doch as en Kristenmensch getauft und konfirmeert worden, und wenn ich auch veel sündigt hev, von wegen das Fluchen und das Kömtrinken und de lütten[98] Deerns, so dacht ich und denk ich noch: wenn de Köm nicht zum Saufen und de lütten Deerns nicht tom Leifhewen da sind, denn had de leif Gott se ok nicht erschaffen. Also so schlimm mit meine Sünden wäre das nu nicht. – – – Ja, wo wär' ich nu noch? Ach so! Bei die Niggers, als sie uns festbanden. Na, die verankerten uns nun, jeden an einen Baum; die beiden anderen mir gegenüber. Dann drehten sie aus trockenes Gras dicke Knebels, die sie uns in die Hälse wrangten, so daß wir weder schreien noch jappen konnten. Darauf käm ein von die schwarzen Kerle mit ein Pott voll rote Farbe und begann unsere Nasen damit einzuseifen. Ich hatte, wie gesagt, ein Grasknebel im Halse, wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich lauthals lachen müssen, so sahen die beiden anderen aus!
Ihre Gurken glühten und glommten wie frisch geputzten Backbordpositionslaternen in dunkler Nacht.
Aber, wie gesagt, lachen konnte ich nicht, denn mir stach ja ein Bündel Gras ins Maul, und außerdem würde mir auch schnell genug das Lachen vergangen sein, denn ich, oder richtiger mein Galion, erhielt Besuch; wie es schien, ein Liebhaber von die rote Farbe. Und das war so eine Art Wespe, die sich ohne weiteres und ohne viel zu fragen auf meine Nase niederließ und sich dort breit[99] machte. Sie lief hin und her, schnurrte und tanzte und wollte schließlich auch nach Binnenbord. Doch das kitzelte ganz infam; ich mußte niesen.
Nun wurde die Bestie wild, brummelte ein paarmal in fürchterlicher Fahrt hin und her und stach mir dann pardauz mitten auf die Nasenspitze. Kaum war dies geschehen, kamen noch so ein paar fleigende Beesters und machten das erste Beest Gesellschaft. Meine Kollegen drüben ging es auch nicht besser; sie hatten auch Besuch bekommen und mußten auch gräsig niesen und prusten.
Und de entfamigten schwatten Kierls lachten und lachten, als wenn sie sich kaputt lachen sollten; und dabei riefen sie: ›Dannebrogsnäs', Dannebrogsnäs'!‹ und lachten und lachten immer döller.
Na, ich glaube, ich hätte selbst mitgelacht, wenn ich an ihre Stelle gewesen wäre. Auf unsere Galione waren nun nicht mehr ein, zwei oder drei Stück, nein, hunnert! dusend! Wespen, fleigende Ameisen und weiß der Deuwel was für ein entfamigtes Krabbelzeug da zugange war. Wie Immenklumpen an Immenkörben im Hochsommer sahen unsere Nasen aus. Und da es ganz grauenhaft juckte und kitzelte, mußten wir immerfort niesen, und dafür zwickten und zwackten die Beesters uns, daß uns grün und geel vor den Augen wurde.
Währenddessen waren immer mehr Niggers hinzugekommen,[100] und bei jedem, der hinzukam, riefen sie: ›Dannebrogsnäs'!‹ und wollten sich vor Lachen rein ausschütten.
Da, mit einmal hör' ich einen scharfen Pfiff, und im selbigen Augenblick sind die Schwarzen futsch; verschwunden, als wenn sie weggeblasen wären. Dann nach einer Weile raschelte es im Busch, und eine Abteilung von unseren Leuten, die auf der Suche nach uns waren, kam zum Vorschein. Na, sie befreiten uns ja nun und wrangten uns die Knebels aus den Hälsen, aber als sie uns richtig besahen, lachten sie auch, noch veel döller als de Niggers. Und der Führer, ein Decksoffizeer, schrie, indem er sich den Bauch vor Lachen hielt: ›Himmeldonnerfrikandelle und Schwarzsauer! Hat man je im Leben so was gesehen! Eure Galione glühen ja wie Bomben vor der Explosion! An Bord mit euch, ihr Schweinehunde! Vierzehn Tage Kasten bei Wasser und Brot soll euch gewiß und sicher sein, so wahr als ich Offizeer Seiner Majestät Schiff »Jülland« bin. Ich will euch zeigen, was es bedeutet, sich den Galion verschampfeeren zu lassen!‹
Na, als wir an Bord kamen. Dieses Leben! Was haben sie gelacht!
Unsere Gurken sahen aber auch aus! Angeschwollen waren sie und dick wie Bürgermeisterbirnen;[101] und glühen täten sie wie Mardelspicker im Feuer. Gott bewahre, war das eine Qual!
Wir kühlten ja so viel wie möglich, und der Schwulst ging schließlich auch weg, aber die rote Farbe konnten wir nicht wegkriegen, die ist geblieben bis zum heutigen Tag. Sie ist in die Nase eintätowiert, aber nicht von Tätowatöre, sondern von westindische Insekters.«
Hier schwieg der Sailmacher; sein Garn war zu Ende. Ich aber sprang auf und lief ins Logis, setzte mich auf meine Kiste und lachte, lachte mit der ganzen unbändigen Lachlust der Jugend.
Nun polterte auch der Jungmann herein, warf sich auf die Bank und lachte.
»Nei, Minsch!« schrie er, »dat is jo rein zu doll!«
Er krümmte sich vor Lachen.
Der verehrte Leser fragt jedenfalls erstaunt, warum die Jungen nach dem Logis laufen, um zu lachen.
Tja, dat is nu man so.
Das übermäßige Lachen und das Führen vorlauter Redensarten ist ein für allemal dem Jungen an Bord verboten, wenn er die Erlaubnis erhält, den Erzählungen der Vollbefahrenen zuzuhören. Hierüber hatte mich rechtzeitig der Zimmermann aufgeklärt:
»Solang as du noch nicht drög22 achter de Ohren[102] büßt, büßt du 'n Näswaater. Und wat 'n Näswaater is, de heet dat Mul to hollen, wenn vernünftige Leute reden, und hat aufzumerken und ornlich zuzuhören, damit er was lernt und nachher was versteht. Und dunn hett 'n Näswaater nicht zu lachen, wie 'n dumme Aujust in't Zirkus, und nicht zu fnistern23 wie 'n unschüllig Jumfer op de Hochtid.«
Unter sotanen Verhältnissen blieb uns also nichts anderes übrig, als uns seitwärts ins Logis zu schlagen und dort zu lachen. Und das taten wir diesmal gründlich und mit gebührender Andacht.

Eine kämpferische Natur ist Ludwig Thoma, der Peter Schlemihl des »Simplizissimus« und Mitbegründer des »März«, der unerbittliche Peitschenschwinger über alles, was ihn bureaukratisch, engherzig und heuchlerisch im lieben Bayernlande scheint, der schärfste Satiriker und urwüchsigste Humorist der jüngeren Generation und – darüber hinaus – der beste Schilderer des bayrischen Bauerntumes. Seine Fähigkeit, sich in andere Existenzen einzufühlen, ist erstaunlich: er ist »Lausbub«, Bauernbursch, ländlicher Abgeordneter, Krieger, Vagabund, ist es restlos in Denkungsart, Haltung, Ausdrucksweise, Schicksal. Nie stört eine Wendung, die im Munde des Sprechenden unecht klingt; nie tun sich Ausblicke auf, die über den Horizont des dargestellten Kreises hinausgehen. Es hieße indes das Wesen des künstlerischen Schaffens verkennen, wollte man diese auffällige Unmittelbarkeit der Schilderung als naives Fabuliertalent deuten. Sie ist im gleichen Maße auch Ausdruck einer hohen und gepflegten literarischen Kultur, die das eigene Ich des Autors hinter dem Gestalteten unsichtbar macht. Gerade dadurch, daß Thoma die Menschen und ihre Zustände[105] für sich selber reden läßt, erzielt er soziale Wirkungen, um die sich die Tendenzschriftstellerei mit grellen Farben und dicken Unterstreichungen vergebens bemüht. Und darum wirkt auch sein Humor so außerordentlich: weil er aus den Dingen selbst hervorgeht und nicht erst von der vorgefaßten Absicht des Dichters in sie hineingelegt werden muß. Thoma, der am 21. Januar 1867 zu Oberammergau geboren wurde und vom Jus zur Literatur kam, handhabt mit gleicher Meisterschaft das pointierte politische Gedicht wie den Leitartikel, die kurze satirische Skizze wie den wuchtig ausholenden Bauernroman (»Andreas Vöst«), den auf einen witzigen und schlagkräftigen Einfall gestellten Einakter wie das Volksstück großen Stils (»Magdalena«).
L. Adelt.

Unser guater, alter Herzog Karl
is a Rindviech.
Das neue Jahr soll uns eine andere Behandlung der Majestätsbeleidigung bringen. Ich will es nicht entscheiden, ob die Neuerung viel verbessern wird in der deutschen Welt.
Aber eines weiß ich, und eines bedauere ich.
Mein alter Freund Simon Lackner wird sich nicht mehr so leicht ein billiges Winterquartier verschaffen können.
Und das ist hart.
Denn Simon Lackner ist neunundsechzig Jahre alt; ein herzensguter Kerl.
Jetzt soll er als Greis eine neue Methode ersinnen, nachdem er sechzehn lange Jahre hindurch mit der alten so schöne Erfolge erzielt hat.
Ihr lieben Mitmenschen, denkt euch in seine Lage!
Von Jugend auf war er ein stellenloser Schreinergehilfe; ein fahrender Handwerksbursche. Das ist wohl ein schöner Beruf, wenn der Apfelbaum am Straßenrand blüht, und wenn ein Mensch, der auf dem Rücken im Grünen liegt, mit blinzelnden[107] Augen der Lerche hoch hinauf in die blaue Luft nachschaut. Das ist wohl ein schöner Beruf, wenn die Kornähren sich über dem müden Haupte wiegen und am heißesten Sommertag einen erquickenden Schatten spenden. Auch ist es fröhlich und freudenvoll, wenn noch eine mildtätige Herbstsonne auf den Buckel brennt, und wenn die zerrissenen Schuhe durchs gelbe Buchenlaub rascheln.
Aber wenn die kalten Novemberwinde pfeifen und alte Felber24 in die Gräben rollen? Wenn die Landstraßen aus dem Leim gehen und pfundschwerer Brei an den Sohlen hängen bleibt?
Wenn der kalte Regen mit tausend Nadeln sticht, oder die Schneeflocken wirbeln? Wenn alle warmen Ofenbänke von hartherzigen Bauern besetzt sind, die für einen armen Handwerksburschen nicht zusammenrücken?
Da wird's dem abgehärteten Landstreicher wehmütig ums Herz, und er sehnt sich nach einem trockenen Platz, nach einem Dach, unter dem es nicht tropft.
Simon Lackner widerstand lange, aber endlich kriegte er das Reißen in seinen Gliedern, und er fand ein Mittel, sich zu helfen. –
Im Herzogtum Neuburg regierte Karl III., ein gemütlicher, braver Landesfürst.
Natürlich, Simon Lackner kannte ihn nicht, aber er stand doch in gewissen Beziehungen zu ihm.
Denn wo er in einem Bauernwirtshaus um Gotteslohn eine Halbe Bier trank, sah er von der Wand das dicke Gesicht Karls III. herunterlächeln.
Und er begriff die Gutherzigkeit, welche sich in dem breiten Mund, in den hängenden Backen des Landesherrn ausdrückte.
Er sah mit Liebe in die kleinen, hinter Fettpolstern verschwimmenden Schweinsäuglein und dachte sich, wie bürgerlich und selchermäßig doch oft der liebe Gott die von seinen Gnaden regierenden Häupter ausgestaltet. Kein kleinstes Restchen Feindseligkeit haftete im Herzen des Simon Lackner.
Er liebte den Fürsten auf seine bescheidene Weise und nahm es ihm nicht übel, wenn seine Gendarmen grob und rauhhändig waren.
Denn nicht einmal der allmächtige Gott hat alle seine Geschöpfe liebenswürdig geschaffen.
Warum sollte man's von einem irdischen Fürsten verlangen?
Trotz seiner Hinneigung war aber Simon Lackner gezwungen, alle Jahre einmal dem Herzog Karl III. eine Despektierlichkeit zu zeigen, die ihm nicht innewohnte.
Aber es war eben seine Methode, und es war notwendig, um unter ein schützendes Dach zu kommen.

Wenn zu Ende Oktober die kalten Winde anhuben, ging Simon Lackner zum herzoglich neuburgischen Gefängnisse, welches auf freiem Felde lag, hinaus.
Dort versteckte er sich in einen Holzschuppen, welcher gegenüber dem Eingange der Anstalt lag, und wartete.
Wenn dann einige Gendarmen kamen, trat er allsogleich hervor und schrie mit lauter Stimme:
»Unser guater, alter Herzog Karl is a Rindviech!«
Das erstemal und das zweitemal stürzten die Gendarmen gierig auf den frevelhaften Menschen und glaubten, daß sie einen wichtigen Fang gemacht hätten. Aber schon im dritten Jahre erlahmte ihr Eifer, denn sie wußten jetzt, daß Simon Lackner sich nur auf diese harmlose Weise ein Winterquartier verschaffen wollte.
Simon Lackner mußte oft und oft schreien, bis sie ihn gefangen nahmen.
Und das wiederholte sich sechzehn Jahre lang mit schöner Regelmäßigkeit.
Man wußte es nicht mehr anders.
Wenn gegen Ende Oktober schwere Wolken am Himmel aufzogen, schaute der Gefängnisinspektor in die herbstliche Natur hinaus und sagte: »Jetzt wird der Lackner bald wieder schreien.« Und richtig:[111] den andern Tag zogen sich nasse Bindfaden vom Himmel zur Erde herunter, und vom Holzschuppen herüber brüllte es: »Unser guater, alter Herzog Karl is a Rindviech.«
Die Gendarmen lächelten; Simon Lackner lächelte und betrat freudig die Halle des Gefängnisses, wo ihm der Inspektor wohlwollend entgegentrat.
Lackner wiederholte zur Sicherheit: »Unser guater, alter Herzog Karl is a …«
»Weiß schon, weiß schon,« sagte der Inspektor, »Sie kriegen schon Ihre fünf Monat.«
Wenn die Amseln pfiffen, kam Simon wieder heraus und walzte fröhlich durch das Herzogtum Neuburg.
Und wo er in einem Wirtshaus das Konterfei seines lieben Karls III. sah, lächelte er ihm verständnisinnig zu. Er hatte ja nie vergessen, ihn den guten, alten Herzog zu nennen, und das mit dem Rindvieh war nicht ernst gemeint.
Jetzt wollen sie den schönen Paragraphen ändern, mit dem mein Freund Simon Lackner seit sechzehn Jahren sich recht und schlecht über die Wintersnot hinweggeholfen hat.
Ist das nicht hart?
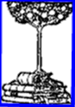

Die alte Poetenstadt Graz beherbergt in unsern Tagen das Dichterquartett Rosegger, Wilhelm Fischer, Ertl, Decsey. Fischer ist der Romantiker unter den vieren, ein feiner und bedachtsamer Sinnierer, der durch alle Jahrhunderte deutscher Vergangenheit wandelt, um sich ein wenig fremd und unbehaglich an der Schwelle unserer Zeit wiederzufinden. Seine Dichtung fließt aus zwei Quellen: einer lyrischen und einer philosophischen. Beide durchdringen und vereinen sich zu einer »Poetenphilosophie«, die dem Gedanken lebendige Form und Seele gibt. So anmutvoll und innig Fischer die Dinge der Natur und des Menschenherzens zu schildern weiß, so stehen sie doch nie artistisch für sich, sondern immer unter der höheren Einsicht ihrer eigentlichen Bedeutung: »Es ist der Vorzug höherer Naturen, daß sie die Welt mit allen ihren Einzelheiten immer symbolisch sehen.« Diese Einsicht aber ist Fischers unerschütterlicher Glaube an das ursprünglich Gute im Menschen, ist Ehrfurcht und Andacht vor der Gottestat der Schöpfung, ist – mit einem Romantitel Fischers zu reden – »die Freude am Licht«. Ja, Licht, viel Licht ist in seinen Büchern:[115] Licht, Wärme – Sonne. Sie wärmen innerlich und beglücken, mögen sie nun von alten Sitten, von Kindern, Märchen oder Gedanken erzählen. Aber freilich: die Jahre des Naturalismus waren Fischers nach innen gekehrter Art nicht gewogen; erst als die Gemüter aus der Dürre des nackt Gegenständlichen wieder nach tieferer Erquickung verlangten, besann man sich auf den Grazer Stadtbibliothekar und Stadtpoeten und griff froh erstaunt nach seinen neuen und älteren Büchern als nach dem lange vermißten Labetrunk. Viele, viele Jahre hat der Dichter (der am 18. April 1849 zu Tschakathurn in Ungarn geboren wurde) darauf warten müssen.
L. Adelt.

Die Rebenbäckerin.
Frau Walburga, Meisterin ihres Hauses und eine jugendliche Witwe, war nicht ganz so schlank wie die Reben, die sich an ihrem Fenster emporrankten, aber sie war blond, rosig, rundlich und ein hübsches Weib. Sie hieß auch die Rebenbäckerin, und nahrhaftes braunes und weißes Gebäck ging aus Stube und Laden hervor, die Käufer anzulocken und die Nachbarschaft zu versorgen. Sie wohnte in der alten Stadt Graz, nahe der südlichen Ringmauer und lebte unbeengt und ungekränkt, es sei denn, daß ihr die Ermahnung der Zunftmeister, sich baldigst wieder zu verehelichen, zuweilen Sorge schuf. Jedoch erkannte sie es selber als billig und ordnungsgemäß, daß die ehrsame Bäckerinnung wieder vervollständigt werde und daß sie, Frau Walburga, sich ein Haupt und einen Meister in nicht zu ferner Zeit erwählen müsse. Zwar besaß sie einen Altgesellen, der Heinrich Harer hieß und ihres Gewerkes redlich und emsig pflog, und der ihr nicht übler dünkte als ein anderer Mann, von dem es im Hinblick auf das Weib[117] heißt: er soll dein Herr und Meister sein. Allein dieser Geselle hatte unterschiedliche sonderbare Eigenschaften, so daß sie sich nicht entschließen konnte, ihn zu einem vertrauteren Umgange zu ermuntern. Denn er mochte weder seine eigenen Guttaten ins rechte Licht setzen, noch die Vorzüge anderer nach Gebühr würdigen und war infolgedessen unfreundlicher, als es sich in der Nähe eines jungen Weibes geziemte, das von der Zunftobrigkeit verhalten wurde, sich nach einem passenden Ehewirte umzusehen. Und da sie es als den Brauch ihres Geschlechtes erkannte, dem Manne ein begehrtes Glück zu spenden, und dieses Gesellen Herz nicht gläubig genug schien für die Offenbarung eines solchen: so blieb sie die Meisterin und er der Knecht. Sie zuckte die Achsel, wenn sie seiner in der einsamsten Stunde gedachte, und schüttelte den Gedanken an ihn wieder ab. Das Gewerke jedoch gewann unter seiner Obhut eine günstige Ausbreitung, und dessen war sie wohl zufrieden.
Dann grüßte sie noch ein zweiter Geselle im Hause als Meisterin. Dieser war um einige Jahre jünger als Heinrich Harer, gehabte sich meistens wohlgemut, dankte dem lieben Herrgott für das Leben und alles holdselige, was darin sprießt, gar herzlich und schätzte demgemäß alles nach rechtem Verdienste; auch war er mit sich selber nicht unzufrieden. Er hieß Jost Seydlin.
Die beiden Gesellen hielten gute Kameradschaft miteinander, und Frau Walburga war auch damit wohl zufrieden.
Zuweilen dachte sie: »Wäre Jost, der wohlgemute Mann, mein Altgeselle, so würde sich das leichter fügen, was ich einmal zu tun verhalten bin; denn er ist hellen Angesichts und klaren Gemütes und würde sich leichtlich zu mir finden, sobald ihm nur mein Auge ein wenig zusprechen wollte in aller Züchtigkeit und ihm sagen, daß seine Art mir nicht zuwider sei; aber so ist er es nicht, sondern Altgeselle ist Heinrich Harer, der weiß nicht zu schätzen, was ein braves Weib wert ist.«
Beide Gesellen waren von guter Herkunft und im Unterlande geboren, Bürgersöhne, deren sich keine rechtschaffene Frau zu schämen brauchte, um mit einem von ihnen nach abgelegtem Witwentuch im hellen Gewande jugendlich und rosig zur Kirche zu gehen. So schaltete Frau Walburga denn über beide und über alles andere Gesinde als Haupt im Hause und mußte noch zur Zeit vergessen, daß über des Weibes Leib des Mannes Haupt ragen soll.
Eines Tages ging sie eine weise Frau um Rat fragen. Diese wohnte im Davidgäßchen und war kundig eines tiefen Blickes in verborgene Dinge.
»Sag mir an, gute Frau,« sprach die Meisterin,[119] »was du von meinen künftigen Tagen zu wissen vermagst. Was mir zu Troste geschehen kann, das will ich gerne von dir hören und dir's auch herzlich lohnen, wenn es zutrifft.«
»Komm wieder am dritten Tage,« sprach die weise Frau.
Und als sie wiedergekommen war, empfing sie den Bescheid: »Du wirst, ehe das Jahr sich neigt, mit einem Manne zur Kirche gehen.«
»Ein Mann! ist das alles?« lachte die Meisterin; »und wie beschaffen ist er, mit dem ich zur Kirche gehen soll?«
»Wie einer, der sich alles holden zu seiner lieben Ehefrauen versehen mag und ihr redlich vergilt, was sie ihm treulich gewährt: so daß du dich ihm unterschmiegen und dein Haupt an seiner Brust bergen kannst.«
»Das soll mir nicht zum Untroste geschehen, Frau Monika,« sprach die Meisterin mit Erröten, »wenn es in Züchten nach dem Gebote der heiligen Kirche über mich erfüllt wird. Aber welcher Gestalt hast du ihn gesehen? Ist er braun oder blond?«
»Ich habe sein Bildnis nur zu nächtiger Weile gesehen, und da war es nicht zu erkennen, ob ihm brauner oder blonder Bart um die Lippen sproßt; aber es ist ein stattlicher Mann, das kann ich dir höchlich beteuern. Laß dir damit Genüge sein.«
»Das will ich,« sprach die Meisterin, lohnte der weisen Frau und ging mit erleichtertem Herzen heim. Als sie über die Herrengasse schritt, kam ihr die Stadtwache mit Pfeifen und Trommeln entgegen, und es gab einen hellen und freudigen Schall. Den nahm sie zur guten Vorbedeutung und lächelte, so daß ihr Antlitz überschienen ward und die Vorübergehenden sagten: »Seht, Frau Walburga, die Rebenbäckerin! Das ist ein junges Weib, das manchem Manne guten Mut geben könnte.«
Sie aber schritt weiter und dachte: »Wen erblicke ich zuerst, wenn ich ins Haus komme? Das will ich mir merken.«
Aber sie erblickte einen, bevor sie ins Haus kam. Denn vom Dache schien etwas Weißes herab, wie eine Gestalt, und als sie nahe gekommen war, blickte sie erstaunt hinan und rief: »Was tust du auf dem Dache, Geselle Heinrich?«
Er antwortete von oben her: »Eine Krähe rupfte das Gras zwischen den Schindeln aus, und einige morsche sind schon herabgefallen. Da rupfe ich das Gras selber aus und lege neue Schindeln an die Stelle von denen, die herabgefallen sind.«
»O du weiße Krähe!« sprach sie lachend, »wie du fürsorglich bist für mein Hausdach!«

Sie sah, wie sicher er sich auf seinem hohen Sitze[122] gehabte, und dachte bei sich: »Herr Mennhart, mein seliger Ehewirt, hätte das Stücklein da oben nicht ausführen können, denn er keuchte schon, wenn er die Treppe hinanstieg, und die Leiter hätte ihn nicht getragen. Ich armes, junges Maidlein, als ich zu ihm mit dem Brautkranze kam, war er schon ungefüge. Nun habe ihn Gott selig!«
Sie ging ins Haus und da kam ihr Jost Seydlin entgegen, grüßte sie freundlich und sagte, daß er alles wohl verrichtet habe und daß das Gebäck schön geraten sei.
Sie lobte ihn und sprach: »Du tust allezeit, wie es einem guten Knechte geziemt, Jost!« und ging in ihre Stube. Dort sann sie darüber nach, wie es sich wohl fügen möchte; denn sie hatte Heinrich Harer zwar zuerst erblickt, aber nicht im Hause, und Jost Seydlin war ihr zwar im Hause begegnet, aber sie hatte ihn nicht zuerst gesehen. Das schuf ihr manches Bedenken den Tag hindurch, bis sie sich zur Ruhe legte. Da wollte sie acht haben auf das, was sie träumen werde, und entschlief mit einem kleinen Seufzer.
Am andern Morgen erwachte sie frisch und erzählte sich von ihrem Traume nicht viel; aber sie sah in ihrem Handspiegel, daß die Wange rot war, wie es sich für eine junge Frau geziemte. Dann ging sie hinab in ihrem dunklen Kleide, über welches[123] die blonden Haare aus dem Kopfbunde hervorglänzten, rief Heinrich Harer und befahl ihm alles, was am Tage zu schaffen war. So sagte sie auch: »Geh' hinaus zu den Deutschherren am Leech und lege die Reitung25 vor um das Brot, das wir ihnen die Zeit her geschickt haben. Sie wollen nämlich die Abrechnung für das vergangene Vierteljahr, und bringe das Geld heim. Aber von morgen an schickst du mehr hinaus als bisher, wie dieser Zettel hier besagt, denn sie sind zufrieden mit unserer Art und bestellen auch Weißgebäck für Herrentisch und Siechensaal.«
Darauf ging Heinrich in seine Kammer, legte die Rechnung und zog seine blaue Sonntagsjoppe an, strich sich das dunkle Haar zurecht und machte sich auf den Weg. Bald schritt er durch das südliche Stadttor hinaus und ließ sich die sonnige Luft um Stirn und Schläfen streichen. Wenig acht hatte er der Blumen, die aus dem Grase lugten; doch als er auf den grünen Anger kam, da war ein Teich und es flog ein Storch auf, der erregte seine Aufmerksamkeit. Und wie das schon kommt, spann er seine Gedanken fort, als er weiter schritt:
»Wer unter eigenem Dache sitzt, sprach er, hat es gut; er erfreut sich an Weib und Kindern, ist[124] Stadtbürger und die Leute schenken ihm Achtung. Er legt seinen Fleiß daran, seine Habe redlich zu mehren, und sein Wort gilt viel in der Zunft, wenn er zu reden anhebt. Wird er alt, kann er eine Tochter aussteuern oder einen Sohn in die Fremde schicken, auf daß er sich die Welt mit eigenen Augen betrachte. Kommt dann die Zeit, so sagt er sich: ›Das ist ein gutes Tagewerk, wo das Leben mit Arbeit vollbracht ward. Auch hab' ich leidlich gut Gemach all meine Tage gehabt und meinen Leib mit Ehren gefristet. Das hat Gott immerdar für mich gewaltet, weil ich seines Rates in Demut gepflegt habe nach der Stimme des Gewissens!‹ Also möchte einer sagen und wäre zufrieden. Ich aber bin ein solcher Mann nicht, weil ich mir nicht getraue, an etwas mich herzlich zu freuen, aus Furcht, daß es nicht anhalten und allzu rasch verschwinden werde. Täusche ich mich jedoch darin, so will ich es meinem lieben Herrgott im Himmel immerdar danken.«
Und er blickte in den blauen Himmel hinauf und machte ein ernsthaft Gesicht, das gar finster aussah. Das bemerkte der Pförtner noch, als Heinrich am Leech angelangt war und in das Haus der Deutschherren schritt; denn jener sprach:
»Geselle, schenkst du mir einen guten Tag, so mache keine bösen Falten dazu. Du hast noch eine[125] glatte Stirn; warte, bis die Zeit dir die Jahre, die du ihr schuldest, in Kerben einschneidet. Das wird sie getreulich tun, so dir wie mir, der ich alt bin. Doch ist mir ein fröhlich Antlitz willkommener denn eines, worüber der Schatten eines Raben geflogen ist.«
Da lächelte Heinrich ein wenig und erwiderte: »Bruder Stockald, Ihr seht mehr, als ich Euch zusprechen kann; denn ich bin ein fröhlicher Bursche, der immer sagt: Nimm's, wie du's findst. Und find' ich Euch wohlgemut, so verdrießt es mich nicht, das weiß Gott.«
Und er schritt hinein zum Kastner, legte seine Rechnung und empfing das Geld.
Als er wieder in den Hof kam, sah er durch das Gatter den Gartenmeister in den Beeten schaffen und Pflänzlinge einsetzen. Dieser rief ihn zu sich, und Heinrich ging in den Garten und gesellte sich auf eine Weile dem freundlichen Manne und sprach: »Bruder Pilgram, Ihr schafft rüstig!«
»Wie sollte ich nicht, Geselle Heinrich! Scheint doch die Sonne, das Erdreich ist warm und feucht, und der Brodem, der aufsteigt, duftet mir ins Herz. Noch liegt der Schnee auf der Kuppe des Schöckels und die Gleinalpe ist weiß, doch auf dem Rosenberge grünt es, und es blüht in den Tälern. Arbeit schafft uns Zufriedenheit. Nimmt dich das wunder?[126] So lange du wirkst, lebst du: das sag einer dem andern.«
»Jawohl. Seid Ihr auch glücklich, Bruder Pilgram?«
»Was heißt das, glücklich, mein Geselle? Ich bin ein alter Mann und tanze nicht mehr. Hab' auch wenig im Leben getanzt. Ich habe Genügen; das ist alles. Beginnt es zu sprossen, so lebe ich jedes Frühjahr aufs neue auf mit meinen Pflegekindern, den Pflanzen vielgestalteter Art. Man sagt: der tanzt gut, dem das Glück aufspielt; aber der schreitet geruhig, der den Tanzlärm weit im Rücken hat, wie ich, und mit keinem wüsten Kopfe zu Bette geht, wenn das Spiel aus ist. Mit mir hat es in all diesen Tagen keine Not mehr. Du aber, Geselle, magst noch tanzen.«
»Das ist wahr, Bruder Pilgram. Wo ich vor mich hinschaue, da wächst ein Tanzboden heraus. Meint Ihr nicht?« Und er lächelte ein wenig.
Darauf sprach jener: »Sei nicht vorlaut, mein Geselle. Dein Kopf steht immer zwischen den beiden Achseln, wo du auch hinschauen magst. Du bleibst der gewisse Heinrich Harer. Und ist in deinem Kopfe klarer Wein, so kannst du das Leben genießen. Sage nur niemals: Wann hab' ich nicht gewollt, dann hab' ich gesollt; und alles ist gut.«
Er setzte den Fuß auf die Gartenschaufel, grub[127] in die Erde und warf die dunkle Scholle auf. Da splitterte etwas unter dem Grabscheite, und es waren Scherben, die in der Erde lagen.
»Siehe da,« sprach er, »tönerne Scherben!«
Er bückte sich, las die Bruchstücke auf und warf sie zur Seite.
»Das mag lange in der Erde gelegen haben. Oftmals schon stieß meine Schaufel auf solch irdenes Geräte, und viele solcher Gefäße stehen unversehrt im Hause. Die hat der Spittler an sich genommen und verwahrt darin allerlei, was er zu Heilmitteln für die Siechen zusammenstellt oder braut. Siehe, da ist wieder so ein Ding!«
Er hob eine kleine Vase auf und reinigte sie von der feuchten Erde, die daran klebte.
Das Ding mit dem schlanken Leibe und dem zierlichen Halse gefiel dem Gesellen gar wohl, und er sprach: »Wenn ich es hätte, das Gefäßlein, ich wollte es mir verwahren.«
Und der Gartenmeister erwiderte: »Trag es dem Bruder Spittler hinauf, vielleicht schenkt er es dir, denn er hat schon viel davon auf dem Gesimse seiner Arzneistube stehen.«
Das ließ sich Heinrich gesagt sein, nahm das fremdartige Ding und begab sich damit zum Spittler hinauf. Dieser war ein leutseliger Herr und hörte das Anliegen des Gesellen mit Vergunst an. Er[128] sah ihm freundlich ins Antlitz und sprach dann schalkhaft:
»Heinrich Harer, ich habe dir schon längst etwas Gutes zugedacht, weil dein Gebäck uns ohne Tadel zu Hofe kommt. Dies nun hier ist ein gar wundersames Gefäß, das du mir gebracht hast, und dein guter Geist hieß es dich von mir begehren. Denn es stammt aus grauen Zeiten und ward aus dem heiligen Lande nach der Stadt Rom getragen. Und da die Römer vor vielen, vielen Jahren auch hier hausten, so haben sie es in der Erde zurückgelassen und verborgen wie ein seltenes Gut. Aber zum Schatze soll es erst für dich werden durch das, was ich hineingeben will, nämlich etwas Geheimes, was ich aus dem heiligen Lande mitgebracht habe: etwas von einem köstlichen Elixiere. Und so lange du es besitzest, wirst du zufrieden sein. Das merke dir.«
Und er ließ den erstaunten Heinrich stehen, ging in ein Nebengemach und kehrte nach einer Weile mit dem Gefäße zurück. Das war nun mit einem dichten Stöpsel versehen, und etwas wie ein lieblicher Rosenduft stieg daraus empor, trotzdem es sorglich verschlossen war.
»Da nimm, Heinz. Du trägst nun die Zufriedenheit nach Hause, die ist in diesem Gefäße verschlossen. Verwahre es wohl und öffne es niemals, sonst fliegt sie dir davon.«
Er entzog sich dem Danke des Gesellen, der zufrieden mit seinem Schatze in die Stadt zurückging. Zu Hause gab er das empfangene Geld der Frau Walburga, stieg sodann in seine Stube hinauf und verwahrte das wundersame Gut gar sorglich in der Truhe, und dachte noch viel darüber nach, daß er nun die Zufriedenheit bei sich geborgen habe und allen Übeln, die ihn sonst angefaßt, hinfürder stattlich begegnen könne.
Er spottete zwar selber über sich und sprach: »Herz, stelle dich ungebärdig, wie du willst, du hast nun die Zufriedenheit!« betrachtete jedoch das Ding mit Scheu, und der Wohlgeruch, der daraus emporstieg, behagte ihm auf seltsam liebliche Weise.
Seinem Mitgesellen Jost Seydlin aber konnte es nicht lange verborgen bleiben, daß etwas aus der Truhe heraus die Kammer durchduftete, und Heinrich teilte ihm auch mit, daß er ein kleines Töpfchen von Meister Altfried, dem Spittler bei den Deutschherren, bekommen habe und daß er es niemals öffnen dürfe; aber von der geheimen Kraft der Zufriedenheit, die darin verborgen war, berichtete er nichts, weil er selber nicht ganz daran glaubte und doch sich scheute, seinen Unglauben zu verlautbaren.
Dem Jost Seydlin gefiel das Ding, als er es ihm zeigte, gar wohl, und er begehrte es selber zu[130] besitzen. Doch um Geld war es nicht feil und Jost Seydlin sprach mitleidig: »Das ist etwas für ein Weib, das eine feine Nase hat; was willst du damit, Heinz?«
Worauf jener erwiderte: »Daß ich es besitze, dessen bin ich zufrieden. Da sollst du nichts dawider haben, Geselle Jost. Ich will mich an seinem Geruche so lange erlaben, als ich zufrieden bin.«
Und er lächelte ein wenig, als er so sprach.
Jost ließ es dabei bewenden, denn er war gutherzig und mochte sonst auch jedem gönnen, was einer besaß.
Da geschah es aber, daß ein Gesellenschießen des Montags auf Pfingsten stattfand und die Innungen auf die Morellenwiese mit Armbrust und Zielbolzen hinauszogen. Heinrich Harer und Jost Seydlin waren auch dabei und wurden in die Rotte der Bäcker, Müller und Metzger eingeschrieben.
Es war ein gar festlich und fröhlich Treiben auf der Wiese, und viele bewährten sich als gute Schießgesellen, die um die ausgestellten Kleinode warben. In aufgeschlagenen Zelten saßen die Frauen und Mägdlein wohlgeschmückt, in festlicher Tracht, und sie ergötzten sich ehrsam und lobten jeden trefflichen Mann. Auch die alten Meister saßen beim Pfingstbiere und Weine inmitten ihrer Sippe als Häupter,[131] lobten Sankt Martin, indem sie sich gütlich taten, und sprachen sich zustimmend aus über jeden gelungenen Schuß; denn es war eine gute Gesellenschaft zusammengeströmt, die mochte jedweder Innung zum Frommen sich reichlich Lob verdienen.
Der Abstand von den Scheiben ward bis zu 140 Schritten abgemessen, und jeder mußte ehrlich mit schwebendem Arm und aufgereckt schießen, wie es die Satzung gebot. Heinrich Harer und Jost Seydlin hielten sich wacker: die Zielbolzen, die mit ihren Namen bezeichnet waren, staken zumeist im innersten Zirkel der Scheibe. Endlich traf Heinrich zweimal den Nagel und war nahe daran, den ausgesetzten Preis von drei Goldgulden zu gewinnen.
Da sprach Jost Seydlin zu ihm: »Geselle Heinz! wenn ich dreimal den Nagel treffe unter den neun Schüssen, die mir noch bleiben und dir den Preis entraffe, was wirst du dazu sagen?«
Worauf Heinrich erwiderte: »Jost, das mag nicht sein.«
Und jener: »Was soll die Wette gelten? Ich will es Sankt Martin geloben.«
»Was du setzest, Jost; ich setze dagegen.«
»Wohlan denn, Heinz, ich wette mit dir um das Töpfchen, was in deiner Truhe liegt und das dir der Meister Spittler vom Deutschherrenhause geschenkt[132] hat und setze dir dagegen mein welsches Weidmesser, dessen Griff mit Silber eingelegt ist.«
Heinrich sprach: »Das gilt.«
Da geschah es, daß Jost Seydlin dreimal den Nagel auf den Kopf traf und damit den Preis und zugleich Heinrichs Vase der Zufriedenheit gewann. Jost Seydlin war ein schmucker Geselle, und die Mägdlein sahen heimlich und offen auf ihn und lächelten ihm auch wohl zu; Heinrich aber war verdrießlich.
Ein Tanz im Grünen folgte auf das Schießen, und da tat sich Jost auch regsam hervor und war vergnügt.
Des anderen Tages öffnete Heinrich die Truhe und gab seinem Mitgesellen das Gefäß, das jener gewonnen hatte, und dachte bei sich:
»Nun ist es mit der Zufriedenheit wieder aus! Meister Altfried, der deutsche Herr, hat es gewiß gut mit mir gemeint. Doch sei es! ich bin nicht geboren, um zufrieden zu sein.«
Jost Seydlin betrachtete das Ding eine Weile und hatte sein Behagen daran; nach einiger Zeit aber sprach er: »Das wird einem schönen Weibe besser in die Nase duften als mir;« und schenkte es der Meisterin. Diese nahm es willig an, weil die Vase überaus zierlich war, und stellte das Geschenk mit freundlichem Danke in ihren Almer zu[133] Kräutern und Heilsalben, die von Zeit zu Zeit für das Haus gebraucht wurden. So besaß nun Frau Walburga das Gefäß, das Heinrich Harers Zufriedenheit sollte sein. Sie aber sprach zu sich:
»Warum hat nicht er selber daran gedacht, mir das Riechtöpfchen zu verehren, bevor er es an Jost Seydlin durch eine Wette beim Gesellenschießen verloren hat, wie mir dieser erzählt hat? Er geht halt andern Dingen nach, als sich mir gefällig zu zeigen, und daß ich viel an ihn denke, dessen wird mir wohl guter Rat. Er will sich keine Gunst von mir erwerben, darum soll sein Lob auch nicht von mir gemehrt werden.«
Und ihr Antlitz, das unter dem blonden Haare heiter wie Tageslicht scheinen konnte, wenn ihr Herz guten Mutes war, wurde wie von einem Wölklein bedeckt, sobald sie Heinrich Harer erblickte. Dieser aber sagte sich:
»Ich weiß nicht, was an der Sache ist; jedoch meine Zufriedenheit habe ich verloren. Immer mehr wird es klar: Meister Altfried hat es redlich mit mir gemeint, und nun habe ich freventlich mein Gut dahingegeben. Das ist zur Zeit in einer Frauen Händen, deren Wille sich wenig glimpflich zu mir neigt, was ich nicht um sie verdient hätte, der ich mich ihres Dienstes fürsorglich angenommen habe. Aber das macht es, weil meine Zufriedenheit nicht[134] mehr bei mir, sondern bei ihr steht; und darf ich verlangen, daß sie mir solche wiedergebe? Nein. Wie sollte ich ihr mit diesem Ansinnen nahen dürfen? Ich will's auch nicht.«
So blieb er unmutig wie vorher, während Jost Seydlin fröhlich mit sich und andern war. Frau Walburga hörte ihm auch freundlich zu, wenn er erzählte, wie trefflich er die Armbrust geführt; auch durfte er mit Fug den Zielbolzen rühmen, der ihm den Preis von drei Goldgulden gewonnen hatte. Sie lachte wohl mit ihm, aber als er ihr einmal zu nahe ins Auge blicken wollte, sprach sie als Meisterin:
»Geselle Jost, diese und jene Arbeit ist nicht getan; merk' auf den Lehrjungen, der feiert, weil du plauderst. Auf mein Gewerk muß ich sehen, daß meine Habe nicht schwinde. Wie sollte ich arme Witib mein Leben fristen, wenn ich nicht darüber wachte, daß alles von statten gehe und daß die Kundschaften zufrieden seien, wiederkommen, wenn sie gegangen sind, und Braun- und Weißbrot der Rebenbäckerin loben! Dabei wird die Habe gemehrt und ich darf mich sehen lassen. Wer hilfe mir sonst! Eine alleinstehende Frau muß in allem zwiefach fürsorglich sein, auf daß die Wirtschaft nicht den Krebsgang wandle. Dazu gehört aber, daß die Knechte ihren Fleiß daran legen, die Arbeit zu fördern!«
»Meisterin,« frug Jost darauf, »müßt Ihr denn immer allein stehen?«
Und sein hübsches Gesicht ward noch lebendiger als zuvor.
Rasch erwiderte sie: »Habe ich dir darüber Rechenschaft abzulegen, ob ich allein stehen mag oder nicht? Soll ich dich etwa um Rat fragen, mit wem ich zur Kirche gehen und zu wem ich mich fügen soll! Du gütiger Heiland, mit den Hauswirten hat es auch nicht lauter Trost, wie ich an meinem Herrn Mennhart erfahren habe, der noch keiner von den schlechtesten war und den Gott selig ruhen lasse! Da muß denn eine Frau vorsichtig sein und nichts übereilen!«
»Meisterin, wenn aber einer käme, der das Handwerk auf fremdem Boden schon gegrüßt hat; der zwar noch kein Altgeselle, aber es bald werden kann; leidlich jung und frisch, aus ehrsamem einheimischem Hause, dessen Vater ein gut Stück Geld in seine Hände zu legen vermöchte, um die Wirtschaft zu mehren; einer, der Euch holden Mut trägt: was würdet Ihr einem solchen zur Antwort geben?«
Da lachte sie hell auf und sprach: »Das weiß ich nicht. Müßte mir ihn wohl eher genau ansehen.«
»Und dann –?«
»Dann möchte ich sagen: Kommt morgen wieder!«
»Und wenn er morgen wiederkäme?«
»Dann wollte ich ihm sagen: Kommt so lange morgen, bis ich Euch sage: Morgen ist heute.«
»Das will ich mir merken,« sagte Jost Seydlin mit zarter Stimme.
Sie aber sprach mit köstlich hellem Lachen: »Geh', geh', Geselle. An die Arbeit. In die Backstube! Da magst du dich erkühlen. Das sei dein Lohn, weil du so mit mir redest.«
Und Jost Seydlin ging von dannen und war rot vor Freude, weil das Auge der Frau ihm zugeglänzt hatte. Er verstand sich auch darunter alles Gute und war mit sich zufrieden. Er dachte sich: »Du bist auf fremder Erde gewandert, Jost, und dir ward sauer und süß bekannt; warum sollst du nicht darauf denken, dir den eigenen Hausstand zu gründen mit einer Frau, deren junger, stolzer Leib noch wie magdlich blüht? Das laß dir gesagt sein, Jost.«
Und er machte einen Freudensprung, als er in die Backstube trat. Dort lag ihm ob zu schaffen, wie es einem ehrlichen Gesellen in seinem Gewerke geziemte: das Brot nach gutem Gewichte kräftig und nahrsam reifen zu lassen, denn der Altgeselle Heinrich war diesmal abwesend und in die Mühle nach Leuzendorf gegangen; weshalb Jost zu allem sehen, überall Hand anlegen und alles überwachen[137] mußte. Dabei war sein Sinnen so wohlgemut und wonnesam in die Zukunft gerichtet, daß er seines Werkes zur Stunde weniger sorglich achtete, als es sonst geschehen wäre.
Das wurde denn am nächsten Tage in unerfreulicher Weise ruchbar. Denn als an einem Wochenmarkttage standen auf dem Platze vor der städtischen Schranne die Bäcker in den Brotbänken und hielten feil. Auch Frau Walburga waltete mit dem Lehrjungen Cyprian, der ihr zur Hand ging, ihres Gewerkes und des Verkaufes.
Der Brotschreiber, Meister Niclas, kam und prüfte das Gewicht alles ausgestellten Gebäckes nach Satzung auf der Wage und tat auch so mit dem Brote der Rebenbäckerin. Da zog er seine Brauen plötzlich empor; er nahm einen zweiten Laib und fand das nämliche wie vorher; er nahm einen dritten Laib und das Ergebnis blieb das gleiche, worauf er verkündete:
»Nach Inhaltung und Ordnung der Brottafel allhiesiger Stadt Graz wird das Gewicht eures Brotes, Frau Walburga Mennhartin, als ungenügend und zu gering befunden; denn es fehlen satzungsgemäße sieben Lot auf das Pfund; weshalb erstlich der Preis von vier Pfennigen auf die Hälfte herabzusetzen ist und Ihr, Frau Walburga Mennhartin, sodann der herkömmlichen Buße verfallen seid.«
Damit ging er und die Rebenbäckerin blieb bestürzt zurück. Ihr war der Markt verdorben und sie dachte, daß sie entgelten müsse, was Spruch und Forderung der Altmänner von ihr heischen würden. Da litt es sie nicht länger zu verweilen, sie verließ den Markt und ging in das Haus des Zunftmeisters, Adam Grasweins. Dieser hatte schon durch den Brotschreiber von dem Ereignis vernommen und mochte gerne ein strenges Antlitz zeigen, jedoch gelang ihm dies der jungen Rebenbäckerin gegenüber nicht gänzlich, als er sie bestürzt in die Stube treten sah. So sprach er denn freundlich:
»Ei, Frau Walburga, Ihr bringt mir böse Mär. Wahrlich, Ihr habt Euch nicht guter Dinge beflissen, als Ihr Euer Brot mit unechtem Gewichte zu Markte brachtet. Da müßt Ihr Buße leisten, wie es die Satzung heischt. Und ist es mir leid, weil es Euch betrifft, eine junge, ehrsame Witib, so vermag ich Euch doch nicht zu helfen. Setzt Euch hieher, liebe Frau!«
Und sie erwiderte: »Meister Graswein, ich habe bisher immer mein Gewerk in Ehren geführt und noch weiß ich nicht, welch böser Zufall dies zuwege gebracht hat, einen meiner Knechte also zu betören, daß er des rechten Maßes und Gewichtes vergessen hat. Nun sagt mir, was soll die Sühne sein?«
»Die Sühne, Frau Walburga! Ei, Ihr müßt ein Bad in der Mur nehmen, weil Ihr so hübsch seid.«
»Ach, Herr Vater, wollt Ihr grobe Wolle spinnen?«
»Mit nichten, Fraue. Mit Euch wäre nur klare Seide zu spinnen. Doch bin ich alt und nicht ledigen Standes; es kommt mir denn nicht mehr zu, um Euch zu freien, was ich wohl noch täte, wenn es anders wäre. Doch der Spruch, der die Sühne bestimmt, lautet: Welcher immer aus der Bäckerinnung Brot mit unrechtem Gewichte in die Bänke bringt, der soll gebüßt werden damit, daß sein Leib in das Wasser der Mur getaucht werde einmalig, ohne daß es ihm weiter zum Schaden gereiche. – Das ist altes Recht, und niemand wird vermögen, Euch davon zu lösen. Nun, werdet nicht herb, liebe Fraue! Ihr wählt Euch einen Stellvertreter, einen Mann, der die Sühne auf sich nimmt, einen Eurer Knechte, der mit seinem Leibe für Euch einsteht. Dann ist es wohl Zeit, daß Ihr ihm den Dienst lohnet, wer es immer sei. Denn er hat auf sich genommen, was nur Euer eigener Hauswirt, wenn er noch lebte, um Recht erduldet hätte. Ist Euch ein solcher Geselle ansonst mit guten Sitten zu Gesichte gestanden und ist er für die Meisterschaft reif, so mögt Ihr ihm wohl Holdes[140] gönnen und mit ihm in gegebener Zeit zur Kirche gehen. Denn seht, die Altmänner rügen es schon lange, daß noch immer um Euretwillen ein Sitz an der Zunftlade leer steht, weil Ihr bis nun Euch kein neues Ehehaupt gewählt habt und keinen Mann, der Euch Meister sei, mit dem Ihr auch Euer Leben in Ehren sänftlich vertreiben könntet. Und so Ihr jemandem Gunst erweisen wolltet, lieblich als es Frauenart ist, das würde Euch von jedem guten Manne freudiglich gedankt werden. Habt Ihr doch zwei Gesellen aus ehrsamen Bürgerhäusern in Eurem Gewerke, die auch Vaterserbe zu erwarten haben: der eine aus Leibnitz, der andere aus Eibiswald; wer von diesen beiden die Sühne auf sich nimmt, der hat Eure Sache vertreten, und sein Haupt hat für Euren Leib gegolten. Darum, liebe Tochter, tu' dich deiner Sorgen ab und gib der Satzung und der Ehe ihren Lauf.«
Also tröstete sie Meister Graswein, und sie schied von ihm sinnend und ging in ihr Haus.
Dort kam ihr Jost mit der Miene eines armen Sünders entgegen. Als sie seiner ansichtig wurde, sprach sie zornig:

»Was hast du mir angetan, böser Knecht? Ei, fürwahr, du hast gestern zuviel des süßen Weines getrunken, und da ist dir ein solcher Rauch und[142] Nebel davon erwachsen, daß du Maß und Gewicht nicht mehr unterscheiden konntest.«
»Besänftigt Euer Gemüt, Meisterin,« erwiderte Jost demütig. »Ich weiß von keinem andern süßen Weine, als daß ich Euch zu tief in die hellen Augen geblickt habe, und davon ist mir allerdings eine solche Wirrnis im Haupte erwachsen, daß ich des rechten Gewichtes verfehlt habe. Auch hat vielleicht die Katze am Backtroge gerochen, was alleweil Unheil bringt, wie Ihr wißt, obgleich ich dem Lehrjungen Cyprian aufgetragen, der Katzenwache zu pflegen.«
»Schweig mir davon, böser Schalk, und rede dich nicht auf die Katze aus. Was du getan hast, das ist mir zum Schaden geschehen. Und soll ich etwa schuld sein, daß du keine Augen im Kopfe hast?«
»Meisterin, eben weil ich Augen im Kopfe habe, die von Eurer Holdseligkeit zu sehr erfüllt wurden, habe ich nicht klar gesehen.«
»Höre, Geselle! dieses Werkes, mich unnützerweile anzublicken, sollst du ledig stehen und dich deiner redlichen Arbeit annehmen. Ach, ich armes Weib, nun soll ich ihn gar verblendet haben, daß er Übles schaffe!«
»Nein, Meisterin, Ihr könnt nur zu gutem Schaffen anregen.«
»Schweig still und bring mich nicht noch mehr auf! Deine sanfte Rede achte ich keine Bohne wert, wenn du kein getreuer Knecht bist, der für die Ehre der Wirtschaft sorgt. Was soll nun daraus werden? Kennst du die Sühne, die auf unrechtes Brotgewicht steht?«
»Ich kenne sie, Meisterin; es ist die Bäckerschupfe. Doch nehme ich die Strafe willig auf mich und gehe für Euch gerne ins Wasser, der ich für Euch lieber durchs Feuer ginge. Was ist auch in dieser Sommerzeit schlimmes um ein Bad in der Mur? ich lasse mich gerne da hineinschnellen, und lachen die Leute, so lache ich mit. Weiß ich doch, daß Euch damit alles wieder ins gleiche gebracht wird, was durch dieses mein leidiges Versehen verschuldet wurde.«
»So? Du willst die Strafe für mich auf deinen Leib nehmen?«
»Das ist mir eben und recht, Meisterin.«
»Das mag nicht sein, Jost. Du könntest dich im Wasser erkälten, denn du bist ein überaus zierlicher Geselle. Mir wäre leid um dich. Das muß Heinrich Harer, der Altgeselle, tun, nicht du.«
»Aber, Meisterin, wenn ich mich der Sühne mit Herzenslust unterwinde um Euretwillen und um meines eigenen Fehles willen, was habt Ihr dawider? Ich bitte Euch, so Ihr mir Gunst erweisen[144] wollt, einem, der Euch immerdar getreulich zu dienen hofft, – so laßt mich tun, wie ich gesagt habe.«
»Nein, das mag nicht sein, Jost. Um dich wär' mir bange, daß du dich zu rasch erkühlen könntest. Heinrich ist härter als du, und mag sich dem billig unterwerfen. Laß es dir gesagt sein und widerrede mir in nichts, soll ich dir fürder gut sein.«
Und ihre hellen Augen lachten ihn an, ob freundlich, ob spöttisch, daß wußte er nicht zu deuten; doch war er zufrieden mit sich.
Sie aber dachte: »Wer gibt mir einen gesunden Rat, wie ich Heinrich Harer dazu gewinnen möchte, daß er mir gehorsam sei?«
Und als dieser aus der Mühle heimkam, rief sie ihn freundlich in ihre Stube und hieß ihn, sich nahe zu ihr setzen, weil sie um eine wichtige Sache mit ihm Rat zu pflegen hätte. Sie teilte ihm zuvor das Ereignis haarklein mit, um zu sehen, wie er sich dazu verhalten würde.
Heinrich sprach: »Das ist uns ein Schade und ein Spott. Wie konnte sich Jost also vergessen? Was hat ihm so kläglich den Sinn verwirrt?«
»Was ihm den Sinn verwirrt hat, Heinrich, wie soll ich das wissen? Doch ist geschehen, was nicht zu ändern ist. Aber wenn du mir hilfst, so habe ich nimmer Sorge um mein Leben. Du[145] sollst dich für mein Haus und Gewerke der Sühne unterziehen, und alles wird wieder eben sein wie vorher.«
»Ich? Was sagt Ihr? Das soll Jost tun. Wer kann mich des verübten Fehlers zeihen?«
»Niemand. Aber wenn du die Strafe um meinetwillen auf dich nimmst, so bist du mein Stellvertreter und gibst mir in meiner Bekümmernis ganze Freude, Heinrich.«
»Meisterin, wie könnt Ihr verlangen, daß ich ins Wasser geschnellt werde um etwas, was ich nicht begangen habe, und daß ich dann in törichter Weise umhergehen soll? Das wäre mir leid.«
»Heinrich, mir liegt es am Herzen, daß ich kein Leid an dir sehe; aber auch du sollst mich aus meiner Kümmernis erretten und mein Gewerk wieder frei machen dadurch, daß du dich fügest. Laß dich den Spott der Leute geringe achten; du bleibst nach wie vorher ehrlich und hast meinen Dank gewonnen.«
»Nein, Meisterin.«
Da seufzte sie und sprach:
»Ach, ich armes Weib, wie freundlos und verlassen stehe ich in der Welt, und niemand nimmt sich meiner an.«
Und eine Träne blinkte in ihrem Auge.
Da ward Heinrich bewegt und sagte:
»Meisterin, Ihr tut mir unrecht!«
»Nein; da hast du meine Hand, ich will nichts von dir begehren, was dir unmöglich dünkt zu erfüllen.«
Sie reichte ihm die Hand, die sie lind in die seine schmiegte, und in ihrem blauen Auge blinkte noch immer die Träne, als sie sich bekümmert gegen ihn neigte, und er vermeinte das warme Blut ihres jungen Leibes gegen sich rauschen zu hören; doch war es nur sein eigener Herzschlag, der rascher ging. Und da geschah es, daß er plötzlich einen leisen, feinen Duft einatmete, der ihm überaus köstlich schien; der kam aus dem verschlossenen Kasten, in welchen Frau Walburga die Vase gestellt hatte, die Heinrich vom Meister Spittler, dem Deutschherren, bekommen hatte. Ohne daß er wußte woher, stieg es wie eine bezaubernde Zufriedenheit in seinem Herzen auf; sein dunkler Blick, der noch immer nach der Träne in der Meisterin Auge sah, erglänzte wärmer, und er dachte:
»Wer mag ihr widerstehen, so sie bekümmert ist und holdselig wie nie vorher! Sie wirrt mir beinahe den Sinn.«
Und er sprach: »Meisterin, sei es Torheit oder nicht: ich will tun, was Ihr mich heißet.«
Da dankte sie ihm mit Lächeln und freundlichen Worten:
»Wohlan, du treuer Knecht, du hast es um mich verdient, daß ich dich immer in Ehren halte. Nun geh an deine Arbeit! ich will es dem Meister Graswein vermelden, daß du als mein Stellvertreter die Buße auf dich nimmst.«
Heinrich ging, und als er aus dem Bereiche des jungen Weibes gekommen war, sprach er: »Du hast dich in einen törichten Handel eingelassen, Geselle; aber wer war noch nie ein Tor, so ihn ein Weib dazu machen wollte? Das hörte ich immer sagen und habe es nun an mir selber erfahren.«
Und er war wieder unzufrieden; denn das Gefäß der Zufriedenheit besaß Frau Walburga.
Sie aber ging zu Meister Graswein und teilte ihm mit, daß Heinrich Harer ihr Stellvertreter sei. Das lobte der Zunftmeister und hielt Heinrich für den rechten Mann, Haus und Ehre zu behüten, welche letztere nach vollzogener Sühne wieder hergestellt sein werde. Weil Heinrich sich mit gutem Willen ihres Dienstes bisher immer beflissen habe, so sei er es wert, Gunst von ihr zu empfangen. »Und ist er erst dein trauter Ehewirt, so wird er noch deine Habe mehren, liebe Tochter, obzwar dein Anwesen schon jetzt stattlich ist und du des guten Ackers vor dem Tore und des Weingartens am Rosenberge nicht entbehrst, wie ich weiß.[148] Das sei dir auch herzlich gegönnt, daß du dich wieder mit einem guten Meister deines Lebens freuen magst, denn dir jungem Weibe ziemt solches gar lieblich, wenn auch deine Wange noch mehr erröten wird, als wie jetzt, da ich dieses in Ehren sage.«
»Aber, Vater Graswein,« sprach sie, »wie denkt Ihr gleich so vieles! Behüte mich Gott, daß ich etwas übereilen sollte, was noch lange nicht so nötig ist, als Ihr meint. Habe ich gesagt, daß mein Knecht Heinrich mir so zu Gesichte steht, daß ich nicht an ihm vorbeiblicken könnte? Ach, da müßte ich verunehrt sein, und mein guter Ruf wäre geschmälert! Das sollt Ihr nicht denken, Meister Graswein.«
»Nun, nun, Tochter!« begütigte er sie; »das wird sich alles zur Zeit fügen, und ich gedenke bald fröhlich zu sein, nämlich, wenn du Hochzeit hältst.«
»Das wird noch lange nicht sein,« sagte sie und lächelte dem Altmanne freundlich zu, der ihr auch bedeutungsvoll zunickte, und so schieden sie.
Heinrich aber wartete mißmutig auf den Tag, der ihm von den Zunftältesten, die zur Frist Morgensprache an der Lade hielten, mit Spruch und Forderung bestimmt wurde, für die Verletzung der Brottafel in herkömmlicher Weise zu büßen.[149] Es war der St. Jakobstag, und zwar zur Zeit des Sonnenunterganges, da die Bäckerknechte, die an ihm das Urteil vollstrecken sollten, Feierabend hatten.
Zur bestimmten Zeit bewegte sich denn der Zug mit dem armen Sünder in der Mitte, von einem großen Haufen Volkes geleitet, vom Zunfthause im Sacke aus durch das innere und äußere Murtor bis zur Brücke und schwenkte nach rechts in den Wehrgang ab, der zwischen Strom und Ringmauer lag. Dort war der Schneller errichtet, in dessen Korb sich herkömmlicherweise der notdürftig bekleidete Büßer setzen mußte, um in die Mur geschnellt zu werden. Dann wartete seiner ein Nachen im Wasser, um ihn herauszufischen; und darauf kam der allerspöttlichste Schluß der peinlichen Handlung, indem der getauchte Sünder durch die Gasse der johlenden Volksmenge heimrennen mußte, um sich zu trocknen.
In solcher Weise begann denn auch jetzt das Schauspiel und nahm seinen Verlauf.
Heinrich setzte sich in den Korb, versuchte zu lächeln und blickte finster. Die Stange des Schnellers stand schräg über den Strom geneigt; die Seile, welche in den Rollen gingen, wurden angezogen und der Büßer schwebte hinan; dann ließen die Knechte die Seile plötzlich fahren und der Korb[150] mit dem Insassen wurde dermaßen in die Flut geschnellt, daß die Woge darüber hinwegrauschte und kein Haar am Kopfe des Büßers sichtbar blieb.
Alsogleich begannen sie den Korb wieder emporzuwinden, der Nachen war bereit, um den Getauchten aufzunehmen; aber da war das Unerhörte geschehen: ein Schrei des Staunens und des Entsetzens erhob sich, denn der Korb war leer. Hatte der Darinsitzende sich nicht an den beiden Henkeln festgehalten, oder geschah es durch andere Ursache, genug, die Woge hatte ihn mitgerissen, er war fortgespült worden: Heinrich Harer war verschwunden.
Die Sonne war hinter dem Frauenkogel untergegangen, der Strom floß halb im Dämmer, halb im Lichte des Abends dahin, und wie auch alle spähen mochten, kein menschlicher Leib war fernab in der Flut zu erblicken. Ausrufe des Bedauerns und der Klage erhoben sich laut und lauter: »Er ist tot! er ist dahin, der wackere Heinrich ist verschwunden. Die Mur trägt seinen toten Leib nach Wildon hinab!« Nur einige besonnene Männer meinten, daß Heinrich unter dem Wasser davongeschwommen sei.
Dieses glaubte auch Jost Seydlin, dem es bekannt war, daß sein Geselle trefflich schwimmen[151] und auch eine beträchtliche Strecke unter dem Wasser den Atem an sich halten konnte, wie er es gesehen hatte, wenn jener in Leuzendorf an der Mühle zu baden pflegte. Freilich schien ihm die Sache nicht geheuer, denn er dachte: Heinrich ist stark, aber die Mur ist doch stärker; und da er sich die Schuld an dem ganzen Ereignis zumessen mußte, so ward sein Herz bedrückt. Doch entschlug er sich wieder bald der Sorge, indem er allen, die umherstanden, sagte: »Sorgt nicht! Heinrich, der kühne Geselle, geht nicht unter. Das hat er mit freiem Willen getan, um nicht gebadet wie eine Maus unter dem Spotte des Volkes heimrennen zu müssen. Das glaubt mir!«
In gleicher Weise suchte Jost Frau Walburga zu beruhigen, die tödlich erschrocken war, als sie zu Hause das Ereignis vernommen hatte, und zunächst in Klagen ausbrach, dann Jost des ganzen Handels zu beschuldigen anfing, so daß er zerknirscht von dannen schlich, jedoch zwischen den Zähnen immer noch murmelte: »Ich verwette meinen Kopf, daß Heinrich heil davongekommen ist.«
Die Nacht war inzwischen hereingebrochen, die Bürger der Stadt hatten den Fall sattsam besprochen und dann ihre Haustüren geschlossen und sich zur Ruhe begeben. Frau Walburga jedoch konnte keinen Schlaf finden; sie saß einsam in[152] ihrer Stube und klagte und rang mit Angst und Hoffnung. Es war dunkel um sie; kaum sandte von außen der halbe Mond etwas Licht herein, der gegen Westen am Himmel stand, und dunkel war ihr Herz und kaum von halber Hoffnung durchleuchtet.
Sie dachte: »Seh' ich Heinrich noch einmal in meinem Leben wieder, so will ich ihm alles Gute, was ich vermag, erweisen, ich armes Weib! Ist es aber, daß er gestorben ist, dann will ich keine Freude mehr im Leben haben. Hilf mir, heilige Walburga, mit deiner Fürsprache, und ich will dein Andenken mit zwei der schönsten Wachskerzen minnen, die Meister Sebald, der Lebzelter, in seinem Laden hat! Auch will ich an der Kirchtüre den Armen durch drei Wochen teilen, so viel ihrer dort stehen, das gelobe ich dir!«
Da tönte ein leiser Laut durch die dunkle Stube: »Frau Walburga!«
Sie schrak zusammen, so daß ihr Busen sich ungestüm hob und senkte, und sie lauschte ängstlich.
Deutlich vernahm sie noch einmal den Ruf: »Frau Walburga!« und er tönte vom Fenster her.
Sie raffte sich auf und schritt hoffend und zagend dahin und siehe! draußen schmiegte sich ein Antlitz ans Gitter, und zwischen den Blumenstöcken hindurch erkannte sie im Dämmerlichte der Nacht[153] Heinrich, der an dem Weinrebenstocke an der Giebelseite des Hauses emporgeklettert war und sie mit Namen anrief.
Sie frug ihn mit unterdrücktem Jauchzen freudiglich: »Heinrich, bist du es?«
»Ich bin's,« flüsterte er, »die Haustüre ist verschlossen, öffnet mir, Meisterin.«
»Warte,« flüsterte auch sie, »ich komme hinab. Ach, es sieht dich wohl niemand vor meinem Fenster?«
»Die Rebenblätter verbergen mich, Meisterin,« antwortete er.
»Laß dich wieder hinab, Heinrich, ich komme gleich.«
Sie zündete ein Lämpchen an, nahm den Hausschlüssel von der Wand und ging leise auf den Zehen die Stiege hinunter, barg das Flämmchen mit der Hand und öffnete die Türe. Er kam herein und sie verschloß wieder die Haustüre, faßte ihn bei der Hand und sprach: »Komm, daß dich niemand sehe!«
Das Gesinde schlief schon, nur aus dem hintern Gebäude, wo die Backstube lag, drang ein Lichtschein in den Hausflur und sie führte ihn hinauf in ihre Stube. Dort angelangt, stellte sie das Lämpchen auf den Tisch und sprach: »Du hast dich in dem Murwasser erkältet, Heinrich.«
Sie öffnete rasch eine Spinde und gab ihm ein Kleid, das einst Herr Mennhart getragen hatte, und gebot ihm, sich darein zu hüllen, daß er sich erwärme, während sie sich abwandte.
Heinrich tat nach ihrem Geheiße, und dann kehrte sie ihm ihr ängstliches und doch lachendes Antlitz zu und sprach: »Ach, wie hab' ich mich um dich gesorgt! Wie warst du so verwegen, dem Strom zu trauen! Doch es hat dir nicht geschadet, du lebst und bist da. Wie war ich bekümmert! Ich hätte in meinem ganzen Leben keine frohe Stunde mehr gehabt, wenn dir etwas zugestoßen wäre! Du Armer, hast mein Gebot erfüllt und nur ich wäre schuld an deinem Untergange gewesen! Aber nun ist's gut, und ich will es Gott und allen Heiligen herzinniglich danken, daß dir kein Unheil widerfahren ist. Wie hast du es nur angestellt, böser Knecht, mich so zu verwirren und auch alle Leute, die nichts mehr von dir sahen, als du ins Wasser geschnellt wurdest. Man erzählte mir's.«
»Hätte ich mich sollen dem Spott des Volkes aussetzen und nach Hause rennen? dann wäre ich zeitlebens in törichter Weise umhergegangen. Nein, ich schwamm unter dem Wasser, solange ich es vermochte, und als ich wieder auftauchte, war ich auf einer dämmerigen Stelle des Stromes angelangt, wo man mich nicht sehen konnte. Dann hab' ich[155] mich nach links in den Stadtgraben hinein gewendet; denn ich habe gewußt, daß dort am südlichen Wehrturm ein Wasserpförtchen ist, welches in Friedenszeiten immer offen steht und durch das man leichtlich hereingelangen kann. Dort hab' ich mich nahe der Mauer so lange im Schilfe geborgen, bis die Nacht gekommen ist, daß mich niemand sehen konnte, und dann schlich ich mich behutsam hindurch und bin hierher gekommen, wie Ihr seht, Meisterin.«
»So verwegen warst du, Heinrich! Und das kalte Gebirgswasser! Wie leicht hättest du dich für dein Leben verkälten können! Und deine Hände sind noch starr und kalt; ich will sie dir mit meinen eigenen wärmen. Nein, laß nur! Du hast es um mich verdient. Doch warte, so wird es besser sein.«
Sie nahm ein lindes Tuch und rieb ihm die Pulse an beiden Handgelenken eifrig; dann trocknete sie ihm die noch immer feuchten Haare an den Schläfen und richtete bald Worte des Bedauerns, bald des Vorwurfes an ihn, so daß es Heinrich warm wurde.
»Meisterin, wie sorgt Ihr so traulich um mich!« sprach er. »Mir ist unter Euren linden Händen wärmer denn je geworden, und weil ich Euch so nahe in die Augen sehe, vermeine ich schier, der[156] lichte Mai sei gekommen, der alle Herzen zur Freude bewegt. Ihr seid mir so nahe, daß ich Euch umfassen kann, und da ist mir's, als blühte die Stube um mich her.«
»Nein, laß mich, Heinrich. Und sieh, hier am Arme bist du verwundet, du hast dich verletzt!«
»Geritzt. Das bedeutet nichts.«
»Wie du das weißt! Nein, ich habe ganz nahe eine Heilsalbe im Almer, damit will ich deines Armes pflegen.«
Sie öffnete die Tür des Kastens und nahm, wie sie meinte, das Töpfchen mit der gewünschten Salbe heraus; aber in aller Eile versah sie sich, und es war ein anderes Gefäß, was sie in der Hand hielt. Und da geschah es, daß ihr dasselbe zu Boden fiel und alsbald in Scherben zerbrach. Ein wundersamer Duft erfüllte plötzlich die Stube.
»O weh!« klagte sie, »wie habe ich fehlgegriffen! Das ist das Riechtöpfchen, welches du, Heinrich, vom Meister Spittler bekommen hast, und nicht die Heilsalbe: das liegt nun in Scherben.«
Heinrich aber ward verwirrt und dachte: »Liegt nun meine Zufriedenheit in Scherben, so muß die Fraue sie mir wiedergeben. War es mir doch vorher, als blühte die Stube um mich her. Nun blüht es in der Tat plötzlich wie von tausend Rosen; solch köstlicher Geist war in der Vase verborgen,[157] daß davon die Stube in einen Rosengarten verwandelt ist und ich wie trunken bin.«
Dann sprach er: »Meisterin, als mir der deutsche Herr das Töpflein geschenkt hat, da pries er es als gar wundersam. Es stammt aus grauen Zeiten und ward aus dem heiligen Lande hierher getragen. Aber zum Schatze soll es erst für dich werden, Heinrich – so seine Worte – durch das, was ich hineingeben will, nämlich etwas Geheimes und überaus Holdes. Und solange du es besitzest, wirst du zufrieden sein. Also war meine Zufriedenheit in dieser Vase verschlossen, die ist nun verloren. Jetzt steht aber die Sache so, daß der Geist, der darin verschlossen war, mein Herz trunken gemacht hat und unzufrieden, und nur wenn Euer Herz, Meisterin, sich zu mir in Liebe gesellt, kann ich wieder zufrieden werden. Und trunken wie ich bin, vermeine ich, daß sich das Glück zu mir gewendet hat, und ich will es festhalten und nimmer verlieren.«
Da vergaß er auf alles, begann das junge Weib zu trauten und wollte um sein Mannesrecht mit ihr dingen.
Sie aber entrang sich bald ihrer Schwäche, hielt ihn fern und faltete die Hände bittend:
»Nein, Herzensheinz! das sei dir verwehrt! Ich habe dich auch lieb, aber so deine Treue mir unverloren[158] bleiben soll, darfst du nicht deinen Willen wider Gott vollbringen. Denn ich will früh und spät der Zucht und Ehren pflegen und nur, wenn wir zueinander gebunden sind durch das Wort des Priesters in der Kirche, dann will ich dich deiner Treue genießen lassen und dir Macht über mich geben. Denn dann steht es auch in meinem Willen, daß ich dir hold sei. Bis dahin aber bin ich dir fremd, Herzensheinz, und du sollst mir gehorchen, wenn du mich lieb hast. Dann will ich dir auch dereinst als dein Eheweib freudiglich Gehorsam leisten. Nun aber sollst du gehen, weil es nicht gut ist, daß wir länger beisammen bleiben.«
»Sei es denn!« sprach er leise. »Mein Wille und meine Zufriedenheit stehen bei dir, und darf ich um dich freien und bist du mein holdseliges Weib, so will ich Zeit meines Lebens der Unzufriedenheit widersagen.«
Und also schied er von ihr.
Da hatte die weise Frau Monika und auch Meister Graswein, der Altmann, doch recht behalten. Denn eine fröhliche Hochzeit ward am St. Martinstage gefeiert, als Meister Heinrich Harer mit seinem angetrauten Weibe aus der Pfarrkirche St. Egydi mit Festgeleite nach Hause kam. Das wird ein zufriedener Mann werden, dachte sich mancher. Am Abend tanzte auch Jost Seydlin[159] fröhlich, und als er in die Nähe der jungen Ehefrau kam, sagte er: »Heut ist morgen, nicht wahr, Meisterin?«
»Ja, heut ist morgen und das ganze Leben.«
Jost aber dachte sich: »Ist's nicht die, so wird es wohl eine andere sein, die ich bekomme,« und war mit sich zufrieden.

1 merken.
2 niedere Beamte.
3 freu' dich nur.
4 sobald.
5 still.
6 widerwärtigen Grobian.
7 etwa.
8 Ihr scheint euch.
9 Vergnügen.
10 auch so Einer.
11 Rucksack.
12 Mehlspeise aus Topfen.
13 Herumstreichen.
14 dummer.
15 Eichhörnchen.
16 Eile.
17 Vorderdeck.
18 Schiffszimmermann.
19 Segelkammer, hier: Vorratskammer.
20 Kriegsdienst.
21 Zelte aufschlagen.
22 trocken.
23 unterdrückt zu lachen.
24 Weidenstämme.
25 Rechnung.

Als 41. Band der »Hausbücherei« ist erschienen:
Schelmuffskys
wahrhaftige, kuriöse und sehr gefährliche
Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande
von
Christian Reuter
Mit einer Einleitung von Dr. Gottlieb
Fritz und Bildern von Ludwig Berwald
= Preis gebunden 1 Mark =
Die Prachtgestalt des Helden mit seiner Renommiersucht und grotesken Erfindungsgabe kann sich ruhig neben Falstaff sehen lassen und übertrifft an komischer Kraft den Münchhausen um ein bedeutendes.
Eins der lustigsten Bücher
der Weltliteratur
… »Das alles ist so meisterhaft und lustig aufgebaut und garantiert so totsicher einige amüsante Stunden, daß man dem netten Buche die weiteste Verbreitung wünschen kann.«

Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 116: pflag → pflog
ihres Gewerkes redlich und emsig pflog
End of the Project Gutenberg EBook of Deutsche Humoristen (7. Band), by
Ottomar Enking and Anna Croissant-Rust and Rudolf Greinz and Wilhelm Schussen and Ludwig Thoma
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEUTSCHE HUMORISTEN (7. BAND) ***
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/3/4/5/53459/